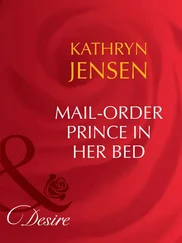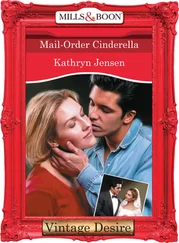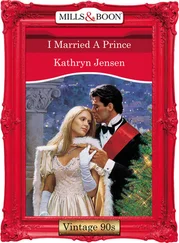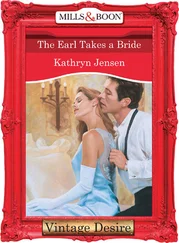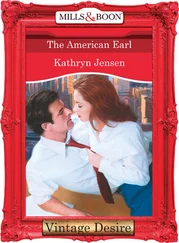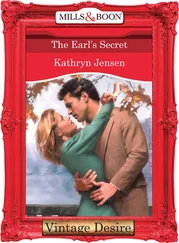Die ganze Zeit über hatte Emilie das Unheil kommen sehen. Jetzt war es da! Am Pult stehend sagte der Allgewaltige mit strenger Mine: „Ich sehe da gewisse Differenzen im Lager. Wie erklären Sie das, Frau Kulka?“
Antoni senkte scheu den Blick. Emilie schaute dem Agenten offen ins Gesicht. Sie holte tief Luft, ließ sich Zeit mit der Antwort. Der trommelte nervös mit dem Bleistift auf die Schreibplatte. Endlich öffnete Emilie den Mund: „Nun, die Sache war die: Als Sie, Herr Hirsch, vorigen Sommer hier waren, wollte ich Ihnen die Bücher zeigen. Eine ordentliche Inventur wäre fällig gewesen. Zumal Sie das Haus geschlossen hatten. Sie entschieden anders. Herr Hirsch, Sie ließen die Leute gehen, ohne zu prüfen, ob jeder nur seins mitnimmt. Sie stellten auch keine Arbeitspapiere aus. Lohn gab es nicht mehr. Nun, da war auch für mich nicht mehr klar, wem was gehört. Alle waren auch aufgeregt. Die Leute sind über alle Berge. Wir haben hier auf alles, so gut es halt ging, dann aufgepasst, mein Mann und ich.“
Respekt, dachte Antoni bei sich, so kenne ich meine Emilie ja gar nicht! Hirsch machte ein derart dämliches Gesicht, dass Antoni sich krampfhaft das Lachen verbeißen musste. Dunkel ahnend, was hier vorgefallen sein könnte, schob der Agent lauernd nach: „Und wovon haben Sie das halbe Jahr lang gelebt?“
Antoni: „Ich war beim Bauern arbeiten.“ Jetzt musste sich Emilie das Lachen verkneifen, denn welcher Bauer stellt im Winter eine Aushilfskraft ein? Der Agent kam ihnen nicht drauf. Er entließ beide in ihr Alltagsgeschäft und schloss die Bücher. Antoni und Emilie gingen hinauf in ihr Dachkämmerchen zu ihrem Kind, stellten sich rechts und links neben dem Bettchen auf und taten aus tiefster Seele den feierlichen Schwur: „Lieber Gott, lass uns um des Kindes Willen immer ehrlich bleiben.“
Mitte Mai zog ein Tross vom Bahnhof die lange Straße hinauf durch das Städtchen zum Hotel. Neugierige sammelten sich am Wegesrand und machten staunende, manchmal mitleidige Gesichter.
Emilie eilte auf die Vortreppe und empfing die Ankömmlinge. Vier Fuhrwerke hielten vorm Haus. Die Menschen stiegen ab und stellten sich zu Grüppchen auf. Nun unterschied Emilie die in Weiß gekleideten Krankenpflegrinnen, deren stattliche Oberin, zwei herrschaftlich aussehende Herren im gesetzten Alter und die in Sackleinen eingehüllten Patienten. Die Oberin kam auf Emilie zu, begrüßte die Hausdame, wendete sich dann an die Fuhrknechte, Koffer, Kisten, Säcke, Möbelstücke, Gerätschaften abzuladen und ins Haus zu schaffen.
Die Pflegerinnen, alles durchweg sehr junge, zarte Mädchen, wurden mit den Worten „Kinder, zupacken! Aber schnell!“ an die Arbeit gescheucht. Die beiden Herren, welche sich als die zuständigen Ärzte zu erkennen gaben, beteiligten sich am Abladen, Verteilen, Einrichten nicht. Sie erkundigten sich bei Emilie nach den vorbereiteten Wohnräumen für das Personal und eilten, für sich ein gutes Zimmer zu belegen.
Die Patienten standen lange scheu, verlegen, in ihrer erbärmlichen Verfassung und Kleidung im Freien. Als das Haus endlich halbwegs eingerichtet war, kümmerte sich das medizinische Personal um diese armen Gestalten und beorderte sie in die Betten der beiden großen Säle: Frauen hierhin, Männer dorthin. Neben jedes Bett wurde ein Stuhl gestellt. Darauf legten die Patienten ihre wenigen persönlichen Gegenstände ab.
Emilies erster Eindruck verfestigte sich von Minute zu Minute: Das sind ja wirklich sehr, sehr kranke Menschen: Zusammenfallende Statur, schmale Schultern, nach innen gewölbte Brust, blasse ausgemergelte Gesichter und dazu dieser pfeifende, rasselnde, schnorchelnde von stetigem Husten unterbrochene Atem. Ihres Sputums entledigten sich die Kranken in kleine, blecherne Schüsseln, die ihnen ans Bett gegeben worden waren. Emilie bedauerte diese Menschen aus tiefstem Herzen. So ein Elend hatte sie noch nie gesehen. Ob die wohl wieder gesund werden?
Die Betriebsamkeit eines Bienenstocks verbreitete sich im ganzen Haus. Ständig putzen die kleinen, weißen Schwestern auf allen Möbeln, Fensterbrettern, Fußböden herum. Die Oberin lief durch die Räume, kontrollierte die Qualität der Arbeit mit einem sauberen Läppchen und gab leise, kurze Anweisungen. Alle Arbeiten waren schweigend zu erledigen, so dass sich Grabesstille ausbreitete. Man hätte schon an einen Friedhof denken können, wenn nicht dieser würgende, kratzende, prasselnde Husten der Patienten gewesen wäre. Die lagen starr in ihren Betten, bis oben hin fest in Decken eingehüllt und zeigten nur die spitzen Nasen sowie tief in den Höhlen liegende, traurige Augen. Der eine oder andere richtete sich zuweilen halb auf, griff nach seinem blechernen Schüsselchen, spie die kranke Last hinein und sank dann erschöpf hinten über. Die sind ja schon vom Tode gezeichnet, dachte Emilie.
Die Oberin, das war Schwester Maria, nahm das Zepter im Hause fest in ihre Hand. Und während Emilie sich noch fragte, welche Rolle im Steinschen Unternehmen sie ab jetzt spielen würde, rief Maria die Emilie schon zum Gespräch. Sie eröffnet mit der Frage: „Was haben Sie gelernt?“ Emilie: „Ich kann verwalten, Arbeiten einteilen, die Bücher führen, waschen, kochen, putzen, einkaufen ...“ Die Oberin, Maria, unterbrach Emilie: „Also nichts!“ Selbstbewusst hielt die einfache Arbeitsfrau entgegen: „Ich habe dieses Haus mit rund zehn Angestellten all die Jahre erfolgreich geführt. Es ist da nie was vorgekommen, das heißt, ich kann schon einiges.“
Maria lenkte ein: „Das will ich gern glauben“, und ergänzte, „nur, da ich erstens beauftragt bin, Sie hier weiter zu beschäftigen, und Sie zweitens keine Vorbildung in Medizin haben, ist mir angezeigt, Sie in der Küche als Helferin einzusetzen.“ Emile schwieg. Sie konnte nichts erwidern. Sie hatte überhaupt keinen Plan. Es ging weiter: „Also werden Sie den kochenden Schwestern, die reihum für unser leibliches Wohl sorgen, zur Hand gehen.“
Die ehemalige Hotelchefin war zur Küchenhilfe degradiert. Niemand hatte jemals daran gedacht, ihr ein Zeugnis auszustellen. Eine dunkle Ahnung kam in ihr hoch: Sie fühlte sich wie von Fäden gezogen und immer an die Stelle versetzt, wo die Familie Stein sie gerade hinhaben wollte. Eine Alternative sah sie nicht. Emilie ging in die Küche.
Am Donnerstag, das war gerade drei Tage nach der Ankunft der neuen Hausbewohner, steigerte sich die Emsigkeit der Schwestern zum Exzess. Emilie registrierte, dass nicht eine einzige Pause gemacht wurde und die Oberin Maria sichtlich zufrieden durch die Räume streifte. Am Abend rief Maria das Personal im Büro zusammen und hielt eine kleine Rede: „Kinder, ich lobe Eure Arbeit. Wieder hat sich gezeigt, wie sehr Ihr im Dienste unseres Heilands jede Aufgabe selbstlos zu meistern versteht.“ Die jungen Frauen lächelten dankbar. Ihre Augen glänzten. Andächtig schauten sie zu der Mächtigen auf. Die ging zum Pult, nahm einen Bogen Papier hervor, stellte eine Kassette neben sich und verkündete huldvoll: „Nun wollen wir beginnen.“
Die Schwestern stellten sich in einer Reihe an. Emilie, die von dem Getue befremdet war, wollte sich still aus dem Büro verdrücken. Maria sah die Magd gerade noch so entschwinden und rief rasch sie zurück: „Bleiben Sie, Emilie. Das gilt auch für Sie.“ Emilie huschte als letzte ins Glied und beobachtete staunend, wie jeder der jungen Frauen ein kleiner Lohn von wenigen Hellern ausgezahlt wurde, sie mit ihrer Unterschrift das Erhaltene quittierte und dann still hinaus ging. Emilie war an der Reihe. Fünf Münzen legte Maria aufs Pult, Emilie schrieb ihren Namen in die Liste und strich dann das Geld ein. Sie stand erfreut, verwundert, verdattert da und konnte es nicht fassen: Sie hatte das allererste Mal in ihrem Leben Lohn erhalten.
Schwester Maria schloss das Quittungspapier und die Geldkassette in den Wandschrank ein und wendete sich dann freundlich an die immer noch verdutzt im Raum herumstehende Emilie: „Nun, wie steht Ihr zum Sabbat?“ Emilie fühlte sich unsicher vor dieser Jüngerin Gottes und antwortete unbeholfen: „Wir feiern eigentlich nie. Das einzige Mal, wo wir gefeiert haben, war, als uns der Rabbiner zu Mann und Frau zusammen tat, meinen Antoni und mich.“
Читать дальше