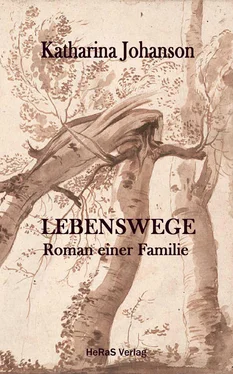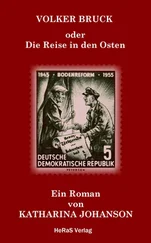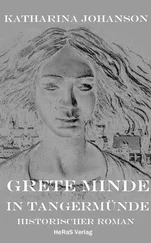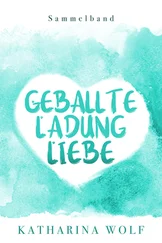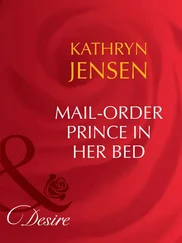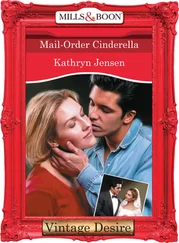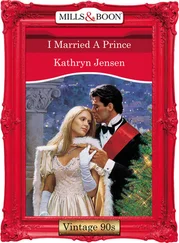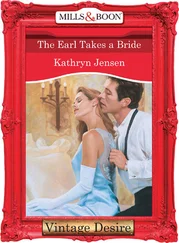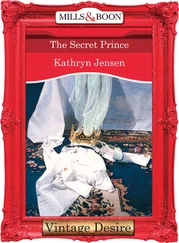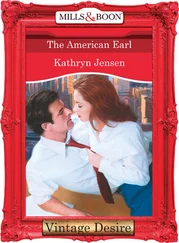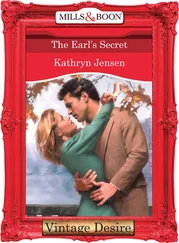Leopold Stein hatte die jüdische Geschichte bis ins Detail studiert. Er konnte sich die Frage beantworten, woher das viele Geld kam, das hier so großzügig investiert wurde und wohin es zu welchem Zwecke floss? Zum einen kam das Geld aus den Opfergaben der vielen armen Gläubigen. Zum anderen aber, und das war der größere Teil des Kapitals, hatten die Juden bar aller politischen Rechte während ihrer Jahrhunderte langen Verfolgung erfolgreich den Handel mit allen nützlichen Dingen sowie den puren Geldhandel betrieben. Man hatte ihnen die Ausübung jeglichen Handwerks untersagt, man hatte sie vom Grundbesitz im Großen und Ganzen ausgeschlossen. Da blieb den Gläubigen nur der Handel. Auf den spezialisierten sie sich. Darin bewährten sie sich. Handel wurde die hohe Kunst und Schule der Juden. Schließlich entschieden sie den Konkurrenzkampf zwischen Fürsten sowie Bürgertum auf der einen Seite und Handelskapital auf der anderen Seite, der als Glaubenskrieg zwischen Christen und Juden ausgefochten wurde, für sich. Die christlichen Fürsten und das aufstrebende Bürgertum in der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht nur zu dieser Zeit, aber ganz besonders dann, neigten zu politischer Unfähigkeit und zu Verschwendungssucht. Ihre Geldbeutel waren immer klamm. Da war die Zeit der Juden gekommen. Der reiche Jude war als Geldgeber gefragt, und er kaufte sich in die Politik ein. In allen europäischen Metropolen, mehr oder minder rasch, mehr oder minder komplett, errangen sie Bürgerrechte, also die völlige Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung.
Der angehende Händler Leopold Stein fasste zusammen: Wir Juden haben also Geld. Sogleich drängte sich ihm aus eigenem Erleben die Frage auf: Alle Juden? Gab es nicht arme und reiche zugleich? Die Masse der Juden blieb bettelarm, und sie wurden von ihren Priestern weiterhin in geistiger Dunkelheit und völliger Abhängigkeit vom Glauben gehalten, so wie Leopolds Eltern auch. Sicher war mit den Jahren die erdrückende Rechtlosigkeit formal aufgehoben und erschien als eine Art Befreiungsschlag. Der einfache wie der vermögende Mann konnte sich in allen Berufszweigen üben. Aber die Bilanz sah doch so aus, dass nur der, der Geld hatte oder von den Priestern bevorzugt wurde, wie eben Leopold selbst, es zu etwas bringen konnte. Für Stein stand daher fest, sich den Priestern ewig dankbar zu zeigen und eine innige Verbindung zur jüdischen Gemeinde immerwährend aufrecht zu erhalten, aber im Stillen doch auch dafür zu sorgen, dass sein eigenes Geldsäckchen immer prall gefüllt sein würde.
Die Priester entließen Leopold Stein nicht in die Welt, ohne ihm eine Ehe zu arrangieren, die den Fortbestand der Juden garantierte. Das passende Mädchen aus gutem Hause mit ausreichend intensiver Bindung ans Jüdische wurde für ihn ausgewählt. An einem schönen Sommertag des Jahres 1860 wurde Leopold Stein in der Pinkas-Synagoge in Prag dem Mädchen Karoline Pfau angetraut. Beide verließen ausgerüstet mit gutem Geld und solider Ausbildung Prag, um in Wien eine Handelsniederlassung zu gründen. Leopold handelte künftig mit Lederwaren. Karoline handelte von da an mit Menschen. Beider Geschäft lief mustergültig, warf ordentlich Gewinn ab. Nach einigen Jahren hatten sie gutbürgerlichen Lebensstandard erreicht, unterhielten ein großes Hauswesen und ihre drei Kinder schauten einer materiell gesicherten Zukunft entgegen.
Ihren Menschenhandel nannte Karoline Stein „Dienstleistungs- und Gouvernanten-Vermittlungsbüro“. Das war eine wichtige Sache: Der sich rasch entwickelnden Industrie und den sich ausbreitenden Haushaltungen des bürgerlichen Mittelstandes führte Frau Stein die notwendigen Arbeitskräfte in geordneter Form zu. Aus den ökonomisch mithin politisch schwer unterdrückten Ländern Ost- und Südeuropas kamen massenhaft frei werdende Arbeitskräfte in die großen Produktionszentren Österreichs und Deutschlands.
Es entstanden riesige Wanderbewegungen mittelloser junger Männer und Frauen. Die waren oft tagelang unter großen Entbehrungen zu mehreren oder einzeln zu Fuß unterwegs. An Knotenpunkten unterhielten die Arbeitsvermittler Herbergen. Hier fanden die Flüchtlinge und die Saisonarbeiter Kost und Logis. Hier wurden sie von den Agenten der Vermittlungsbüros entsprechend den Bedürfnissen der Industrie angeworben, registriert und in Gruppen weitergeleitet. Für all das riefen die Arbeitsvermittler unverschämte Preise auf und pressten den armen Menschen die letzten Silberlinge ab. Karoline Stein richtete ihre Herberge in Lazy Puchow direkt an der slowakisch-tschechischen Grenze ein. Hier war der Übergang von tausenden Wanderarbeitern, die nach Österreich unterwegs waren und zum Teil auch auf der Rückreise diesen Ort durchquerten.
Die Inhaberin der immerhin zweihundertfünfzig Kilometer von Wien entfernten Herberge ließ sich in dem Nest niemals blicken. Dafür hatte sie ihre Leute. Großspurig bezeichnete sie diese Anlaufstelle der Arbeitssuchenden als Hotel. In Wirklichkeit war das aber nur ein ganz mieser Schuppen, in dem die Männer und Frauen in großen Schlafsälen untergebracht wurden, sie ihre wenige Habe als Kopfkissen auf schlecht gezimmerten Bettgestellen ablegten und unter verschlissenen, dünnen Decken nächtigten. Freilich gab es am Abend der Ankunft eine ausreichende warme Mahlzeit und am Morgen vor der Abreise bekam jeder ein halbes Brot als Wegzehrung ausgehändigt. Der Karoline Stein war nicht daran gelegen, die wertvolle Wahre vor der Verwertung in der Industrie verrecken zu lassen.
Auf Schönhof, von wo der Leopold Stein seinerzeit aufgebrochen war, ging das Leben in gewohnter Weise weiter. Der alte Stein lebte nicht mehr lange. Die Sorge und die Mühe um das tägliche Brot ließen ihn schnell altern. Still und zurückgezogen verbrachte er seine letzten Tage und ging dann unbeachtet ins Schattenreich der Ahnen über. Auf dem abgelegenen Waldfriedhof gruben sie ihm ein Grab, ließen den dünnwandigen Sarg in den Boden gleiten, schaufelten Erde darüber und errichteten aus Feldsteinen einen niedrigen Hügel. Für ein Grabmal fehlte es an Mitteln, und so verlor sich bald seine Spur.
Seine zweite Ehefrau, die junge Stein, brachte zwar viele Kinder auf die Welt und kümmerte sich redlich auch um die älteren Sprösslinge der Steins, aber sie hatte nicht viel Freude an ihnen. Das eine und das andere starb noch vor dem siebenten Lebensjahr eines Unfalles oder einer Krankheit wegen. Die ihr verbleibenden Kinder liefen in die Weltgeschichte hinaus, sobald sie halbwegs für sich sorgen konnten. Als Mutter Stein das vierzigste Lebensjahr erreicht hatte, war auch sie erschöpft und enttäuscht von ihrer Lebensbilanz, starb ebenfalls einen stillen Tod, und wurde von lieben Mitmenschen an der Seite ihres Mannes im schönen Grund beigesetzt. Ein Pfarrer oder Rabbiner war in diesen Tagen absolut nicht aufzutreiben gewesen. Da halfen sich die Leute selbst. Die kleine Trauergemeinde sprach ein flüchtiges Gebet, halb jüdisch, halb christlich, verharrte minutenlang im stillen Gedenken und zog dann ab.
Kurz nach der Beerdigung der Frau Stein inspizierte der Hofmeister die Gesindestube. Er wollte prüfen, inwieweit der Raum zu einem guten Preis an neue Dienstleute zu vermieten sein würde. Da entdeckte er auf seinem Rundgang zwischen alter Kleidung und Gerümpel ein wimmerndes, verdrecktes, etwa drei Jahre altes Kind. Barsch fluchte er: „Haben die Juden ihr Balg hier sitzen lassen?“ Das Kind, es war ein Mädchen, erschrak heftig und versuchte sich zu verstecken. Einem Geistesblitz folgend wurde der Hofmeister milde, hob das Menschlein behutsam in die Höhe und sprach beruhigend: „Nicht weinen, mein Kind. Wir werden schon was für Dich finden.“ Der Hofmeister brachte die Kleine, die dann nach ihrer Mutter Emilie gerufen wurde, oben im Schloss bei einer Küchenmagd unter, befahl ihr, für das Kind zu sorgen, es aufzuziehen und später als Hausgehilfin auszubilden.
Читать дальше