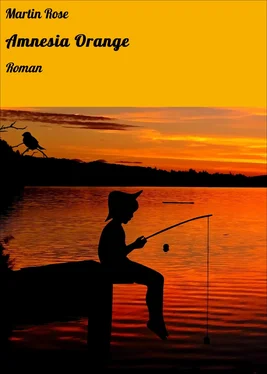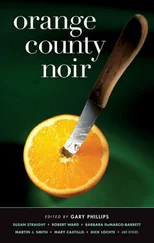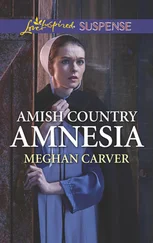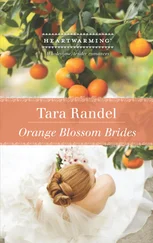Doktor Humpe fragte mich, wie ich als Junge war, und ich sagte, ohne nachdenken zu müssen: „Still, verängstigt, introvertiert.“ Als neun- und zehnjähriger und lange noch darüber hinaus versuchte ich, die bösen Männer zu vertreiben, nachdem ich ein verdächtiges Geräusch in der Nacht gehört hatte und aus dem Schlaf geschreckt war, wie mir meine Muter, viel später, als ich schon Erwachsener war, berichtete. Ich zog ein Bettlaken über den Kopf und lief mit ausgebreiteten Armen durch das Treppenhaus und machte „huuh!, huuh!, huuh!“ Meine Eltern waren belustigt, mein Vater hatte einmal ein Foto machen wollen, doch er war zu müde, um im Keller nach dem Blitzgerät zu suchen. Sie nahmen mich dann widerwillig in ihr Schlafzimmer, in dem ich auf dem Boden auf der Gymnastikmatte meiner Mutter schluchzend und vor Angst auf das erste Tagesicht wartete. An den darauffolgenden Morgen, nachdem meine Mutter bereits aufgestanden war und das Frühstück richtete, sagte mein Vater jedes Mal aufs neue: „Ein echter Kerl weint nicht!“, stand auf und verließ das Zimmer.
In dieser Zeit wurde ich schlagartig schlechter in der Schule. Meine Eltern ließen mich ihre Enttäuschung darüber spüren, da ich in der ersten Grundschulklasse so etwas wie ein Klassenprimus gewesen sein muß, sofern das in dem Alter schon möglich ist. Sie steckten mich in Nachhilfeunterricht, an den ich mich kaum noch erinnere, nur vom Logopäden habe ich sehr deutliche Versatzstücke in meinem Kopf. Es habe mir quasi von einem Tag auf den anderen die Sprache verschlagen, sagte meine Mutter einmal, ich habe nicht mehr klar artikuliert, statt dessen undeutlich gesprochen, mit Wortverdrehungen und Lautverschiebungen. Ich erinnere mich, dass ich Texte im Fischers-Fritze-Fische-Genre rauf und runter beten und auswendig lernen mußte. Ich sehe mich in kurzen Hosen, mit einem Kassettenrecorder in die belgische Schule bei uns im Viertel laufen, in der der Logopäde, ein kahler Mann mit grauen Nackenlöckchen und Mundgeruch, seine Privatstunden abhielt. Die Texte waren auf der Rückseite akkurat zurechtgeschnittener und zusammen gehefteter Tapetenfetzen geschrieben.
„Haben Sie Geschwister?“, fragte Doktor Humpe. Still wurde ich, ein sanfter Schwindel entfaltete sich in der Schaltzentrale. „Ich hatte eine Schwester“, sagte ich, „sie starb, als wir neun Jahre alt waren. Ich habe keinerlei Erinnerungen an sie.“ Doktor Humpe sah mich schweigend an, ich sah, wie seine Pupillen sich weiteten, der Blick des Anglers, an dessen Angelhaken soeben ein Karpfen angebissen hat. „Berichten Sie“, forderte er mich mit ruhigem Ton auf. Ein sonderbares, weil frühzeitiges Vertrauen nahm ich in mir wahr, ich war bereit, ihm von meiner Schwester zu berichten, wenngleich ich dazu weitgehend nur als Kolportage imstande war.
Ich wußte so gut wie nichts über den Tod meiner Schwester. Ich nenne sie meine kleine Schwester, obwohl sie 23 Minuten vor mir auf die Welt gekommen war, im Neondämmer des Kreißsaals an einem trüben Wintertag, an dem vermutlich Nieselregen in grauen Schlieren über das graue Brüssel gefallen war. Die Informationen, die meine Eltern mir wie Brotkrumen hinwarfen, waren knapp gehalten wie eine Polizeimeldung in der Zeitung: In der Nordsee ertrunken, während eines Sommerurlaubs auf der Insel Spiekeroog, von einer Strömung ergriffen und hinausgezogen auf das offene Meer. Meine Eltern hatten mir später gesagt, dass ich Glück gehabt hatte, dass wir beide in die Brandung und in die Strömung gegangen waren, von einer Welle waren wir gepackt und herunter gedrückt worden, und nach Minuten erst war ich aufgetaucht, doch von meiner Schwester hatte man noch nicht einmal den leblosen Körper gefunden, nicht am selben Tag, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten, hieß es in der Überlieferung meiner Eltern, und ich konnte mich an all das nicht erinnern.
Noch heute erinnere ich mich lediglich an Bilder von ihr, an die wenigen, die meine Mutter aus der Asche gerettet hatte, in einem verschlossenen Holzkästchen aufbewahrte und mir manchmal, wenn mein Vater nicht im Hause war, überließ. Sie sind mit Tiefenschärfe in mir gespeichert: zwei schilfgrüne, ungewöhnlich große Augen, mit frühreif kokettem Lächeln, die schwarzen Haare zu knappen Zöpfchen gebunden, die wie Lauchstrünke von ihrem schmalen, blassen Gesicht abstehen. Manchmal geraten die Bilder in Bewegung, verändern sich wie ein Phantombild auf dem Bildschirm eines Kriminalisten ,bekommen Konturen, wenn ich mir vorstelle, wie sie später ausgesehen hätte. Ich sehe sie vor mir mit zwölf, mit fünfzehn, als junge Frau, ich sehe ihr Gesicht von heute: Sie hat nach wie vor ein mädchenhaftes Antlitz, ein paar Fältchen um die Augen, die Lippen schmal und weich, der Teint blaß und schön, ein neugieriger, wacher, schilfgrüner Blick. Die schwarzen Haare trägt sie glatt nach hinten bis kurz über die Schulter fallend, von einem Haarreif über der Stirn gehalten, und so frühreif erwachsen sie aussah, als sie neun Jahre alt war, so wirkt das Gesicht jetzt mädchenhaft und jung.
Es gab Situationen in meinem Leben, nach Tagen, an denen ich nicht an sie gedacht hatte, da sah ich eine Frau in der U-Bahn, ein junges Mädchen auf einem Bahnsteig, eine junge Mutter mit Kinderwagen auf der Straße, und ich erschrak, weil ich meine Schwester sah, einen Kinderwagen schiebend, auf einen Zug wartend, verträumt in der U-Bahn in einem Buch lesend, vielleicht spielte sie mit der rechten Hand an einer Strähne, versunken in eine andere Welt. Es fällt mir schwer, zu beschreiben, was in solchen Augenblicken in mir vorging, ein Glücksgefühl überkam mich jedes Mal mit Wucht, und dann Erschrecken, Verwirrung, Schuldgefühl.
Wenn ich als Jugendlicher und junger Erwachsener in den Alben geblättert hatte, sah ich die blinden Flecken, die sich wie quadratische und rechteckige Schatten über die bebilderten Familienarchive legten. Von manchen der verbliebenen Fotos, die ein hauchdünnes, pergamentähnliches Papier voreinander schützte, schien ein Teil abgeschnitten worden zu sein, die mit geradem Scherenschnitt verkürzten Bildflächen sahen aus wie korrigierte Nahaufnahmen aus meiner Kindheit. Und auch heute noch, wenn ich mir die Fotos ansehe, stechen mir die Freiflächen, die durch den stärker verblaßten Hintergrund beinahe wie eingerahmt wirken, ins Auge. Es gibt ein anämisch wirkendes Foto, das mich am Strand zeigt, das Meer liegt hinter mir und ich blinzele, und an der Stelle, an der das Bild abrupt endet, sind zwei Finger zu sehen, die auf meinem rechten Unterarm liegen, zwei blasse, schmale Mädchenfinger.
Ich erinnere mich, wie ich als Junge, ich muß zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, meinen Vater dabei beobachtet hatte, wie er die Bilder vernichtete. Ich konnte, als habe ich eine Vorahnung gehabt, nicht schlafen, ging zu fortgeschrittener Nachtstunde die Treppe hinunter in die untere Etage. Ich sah meinen Vater durch den Türspalt, sah, wie er auf dem Boden kniete und in Zeitlupentempo die Alben wälzte, einzelne Fotos herausnahm und andere mit einer Schere bearbeitete, bevor er sie dem Album entnahm und in das Feuer des Kamins warf. Manchmal wippte sein Kopf eine Weile hin und her, ein verlangsamtes Nachnicken, bevor er sich der nächsten Seite zuwendete. Lautlos setzte ich mich auf eine der kalten Stufen der Steintreppe, hörte das Lodern des Feuers, das metallene Geräusch, wenn mein Vater die Schere auf den hellbraunen Kachelboden legte.
Vielleicht saß ich auf der Treppe eine Stunde lang, vielleicht länger, ich mußte eingenickt sein, denn mein Vater, den ich nach wie vor durch den Türspalt sah, saß jetzt im Lehnsessel. Er war blaß und regungslos und blickte auf einen auf dem Boden vor sich liegenden Punkt. Von rechts, aus der Küche kommend, hörte ich die leisen Schritte meiner Mutter, die vor dem Kamin stehen blieb. Im Feuer wölbten sich die letzten Ecken und Kanten der Fotos, sie lösten sich auf mit leisem Zischen und einer kleinen bunten Stichflamme. Meine Mutter ging zu meinem Vater, rüttelte ihn sanft, und nachdem er nicht reagierte, ertastete sie seinen Puls, legte ihr Ohr an seinen Mund, schüttelte ihn fester, und als er die Augen zum ersten Mal bewegte, meinte ich, ein Schluchzen zu hören. Meine Mutter beugte sich vornüber, legte ihren Kopf auf die Brust meines Vaters und umklammerte ihn. Sie strich mit dem Handrücken über seine Wange, und mein Vater sah meine Mutter ratlos und verloren an, er ließ sich an ihrem Arm aus dem Lehnsessel ziehen, und ich hörte meine Mutter sagen: „Du legst dich ins Bett, ich mache dir eine Kraftbrühe und einen Lindenblütentee, du legst dich jetzt hin“, und als sie ihn zur Wohnzimmertür führte, lief ich lautlos die Treppe hinauf und verkroch mich unter meiner Decke.
Читать дальше