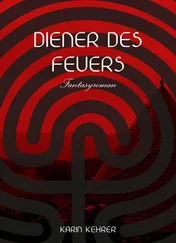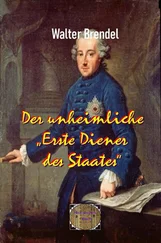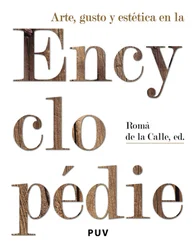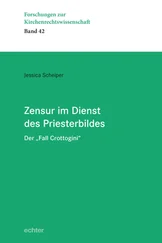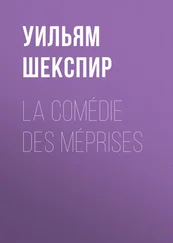Im Kirchenrecht des Spätmittelalters wurde ansatzweise eine Diskussion um die herrscherliche Souveränität des Papstes entfacht. Der Begriff der päpstlichen Vollgewalt (plenitudo potestatis) war zwar in sich vieldeutig und wurde häufig nur als Metapher gebraucht, konnte jedoch auch die Ableitung aller kirchlichen und weltlichen Gewalt vom Papst bedeuten [↗ Papsttum und Kirche]. Einige Juristen näherten die päpstliche an die göttliche Gewalt an: Sie sprachen vom Papst als „Gott auf Erden“, schrieben ihm wie Gott neben einer ordentlichen Gewalt (potestas ordinata) auch eine außerordentliche Gewalt (potestas absoluta) zu und meinten, er sei im Bereich des Rechts zur Schöpfung aus dem Nichts (creatio ex nihilo) befähigt. Der Papst war in den Augen der Juristen unumschränkter Herrscher über das positive Recht der Kirche und konnte sogar im Einzelfall Dispense vom Naturrecht erteilen [↗ Kirchenrecht]. Er war dabei allerdings an das Vorliegen eines gerechten Grundes gebunden. Über die genauen Ausmaße dieser Überordnung des Papstes über das Naturrecht wurde in den Rechtswissenschaften ausführlich debattiert. Erst in der Frühen Neuzeit wurde diese Diskussion auf die weltlichen Herrscher übertragen.
KARL UBL
 Universalmächte
Universalmächte
Die ersten Jahrhunderte des Mittelalters waren ein Zeitalter des Partikularismus. Nach der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers (476) kam es zur Bildung von Königreichen mit germanischer Führungsschicht. Die Struktur dieser Reiche war zunächst nicht gefestigt. Erst zu Ende des 6. Jahrhunderts stabilisierte sich die politische Ordnung auf dem Kontinent durch die drei Reiche der Langobarden, Franken und Westgoten im Westen sowie das byzantinische und das awarische Reich im Osten. Kommunikation und Handel zwischen diesen Reichen kamen zwar nie vollkommen zum Erliegen, erreichten aber im 7. Jahrhundert einen Tiefpunkt. Auch innerhalb der Kirche nahm der Austausch zwischen den Bischöfen ab. Synoden wurden nur auf der Ebene der einzelnen Königreiche einberufen [↗ Konzilien und Synoden], während das Papsttum politisch dem byzantinischen Reich zugeordnet war und eine Verminderung seiner Bedeutung im Westen hinnehmen mußte. Die Folge davon war, daß auch die Rechtsordnung der Kirche zu einer partikularen Verselbständigung tendierte. Die gallische und die spanische Kirche schufen auf Konzilien ein von der römischen und spätantiken Kirche unabhängiges Rechtskorpus. Dieser Partikularismus des Rechts hatte sein Gegenstück in der weltlichen Herrschaft. Die germanischen Könige erließen eigene Rechtsbücher [↗ Germanisches Recht], die zwar alle dem Vorbild des römischen Rechts verpflichtet waren, aber in unterschiedlichem Ausmaß Bestandteile der archaisch-germanischen Tradition aufnahmen. Partikularismus beherrschte schließlich auch die Schriftentwicklung im 7. Jahrhundert. Aus den römischen Vorbildern entwickelten sich in Italien, Spanien, im Frankenreich und auf den britischen Inseln unterschiedliche Schriftarten, die die Kommunikation in Europa erschwerten [↗ Schrift].
Seit dem 8. Jahrhundert wurde dieser Tendenz zum Partikularismus das Streben nach universaler Ordnung entgegengesetzt. Den entscheidenden Umschwung bewirkten die angelsächsischen Missionare zu Anfang des 8. Jahrhunderts. Sie brachten das universalistische Erbe des Christentums (Kol 3,11; Gal 3,28) wieder zur Geltung, sie erneuerten das gesamtkirchliche Bewußtsein und strebten nach einer Vereinheitlichung von Liturgie und Recht. Vorbild sollte die auf Petrus beruhende Tradition der Kirche in Rom sein. Im Kirchenrecht wurde die altkirchliche Tradition wiederbelebt; für das weltliche Recht forderte der Erzbischof Agobard von Lyon († 840) die Abschaffung der partikularen Volksrechte zugunsten der Geltung des universalen römischen Rechts. Politisch schlug sich dieses Streben nach Universalismus in der Wiederbegründung des Kaisertums durch Karl den Großen nieder [↗ Kaisertum]. Sein Sohn Ludwig der Fromme († 840) nahm einen universalen Titel ohne gentile Zuordnung an (imperator augustus). In der Schrift förderte Karl der Große die Verbreitung der karolingischen Minuskel, die im Verlauf der nächsten Jahrhunderte in ganz Europa Verbreitung finden sollte. Dieser erste Schub des Universalismus vollzog sich im Rahmen der wirtschaftlichen Neuordnung Europas (M. McCormick). Sie führte zu neuen Kommunikations- und Handelswegen und erleichterte die Verbreitung der karolingischen Neuerungen (wie den Silberdenar). Im Hochmittelalter wurde der Universalismus zwar auch durch das Kaisertum und das vom Kaiser fortgeführte römische Recht getragen; doch die wichtigsten Impulse gingen in dieser Zeit vom Papsttum aus. Während der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts strebte das Papsttum nach Realisierung des seit der Spätantike formulierten Programms des universalen Kirchenregiments. Erst durch die Etablierung des römischen Primats in der Kirche wurde die effektive Vereinheitlichung des Kirchenrechts möglich. Im 13. Jahrhundert kam dieser Prozeß zum Abschluß. Die Vermittlung dieses universalen Rechts übernahmen die Universitäten, die vom Papst die neuen Rechtsbücher der Kirche in Empfang nahmen und zur Grundlage der Vorlesungen machten. Als Institutionen, an denen die licentia ubique docendi („die überall gültige Lehrbefugnis“) erworben werden konnte, waren sie ein weiterer wichtiger Faktor des Universalismus. Die an den Universitäten gelehrte scholastische Methode war das universale Rüstzeug der mittelalterlichen Gelehrten. Erst der Humanismus machte dieser einheitlichen Methode Konkurrenz und führte zum neuzeitlichen Methodenpluralismus [↗ Denkformen und Methoden].
Das gesamte Mittelalter wurde also durch diese Konkurrenz von Partikularismus und Universalismus geprägt. Der Universalismus diente oft partikularen Interessen und blieb öfter Anspruch als Wirklichkeit; doch förderte er durch den von ihm herausgeforderten Prozeß der Abgrenzung die Ausdifferenzierung der Gesellschaftsbereiche und trug erheblich zur sozialen und ideengeschichtlichen Dynamik des Mittelalters bei.
KARL UBL
 Papsttum
Papsttum
In der Bergpredigt gab Jesus seinen Jüngern den Befehl, sich des Richtens zu enthalten (Mt 7,1). Über ein Jahrtausend später betrachtete sich der Papst, der für sich die Nachfolge des Apostelfürsten in Anspruch nahm, als „ordentlicher und für alle zuständiger Richter“. Die Kluft von der biblischen Forderung nolite iudicare zum päpstlichen Titel iudex ordinarius omnium benennt eine historische Entwicklung, während deren sich die römische Kurie als oberster Gerichtshof der Christenheit etablierte [↗ Papsttum, Kurie, Kardinalat]. Die universale Zuständigkeit des Papstes beruhte vor allem auf seiner Stellung in der Rechtsordnung. In diesem Bereich konnte er seinen Primatsanspruch in vielerlei Form und Gestaltung zur Geltung bringen, während er in Fragen des Glaubens viel enger an die Vorgaben der Heiligen Schrift, der ökumenischen Konzilien und der großen Kirchenväter gebunden blieb. Zu verstehen ist diese Entwicklung nur vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Rechtsgeschichte [↗ Kirchenrecht]. Bereits am Ende des 4. Jahrhunderts stilisierte der Papst seine Rechtsauskünfte nach dem Vorbild kaiserlicher Reskripte und brachte damit das eigene überhöhte Selbstbild zum Ausdruck. In der Zeit des Frühmittelalters, als das schriftliche Recht zugunsten des mündlichen Gewohnheitsrechts an Bedeutung einbüßte, bewahrte sich die Kirche durch die Einverleibung des römischen Rechts eine hohe Rechtskultur. Eine systematische Behandlung von Rechtssätzen und von Rechtssammlungen fand fast ausschließlich innerhalb der Kirche statt. Durch die ständige Fortbildung des Rechts in Konzilien und Papstbriefen nahm die Komplexität im Hochmittelalter derart zu, daß eine Instanz notwendig wurde, um das geltende Recht in seinen Umrissen festzulegen und neue Rechtssetzungen zu ermöglichen. Der Papst nahm diese Stelle seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts ein und schuf ein ausdifferenziertes Rechtssystem innerhalb der Kirche, das den entstehenden Rechtsordnungen der Nationalstaaten als Vorbild diente. Der universalistische Anspruch des Papsttums erwies sich in dieser Hinsicht als ein Faktor der Modernisierung.
Читать дальше
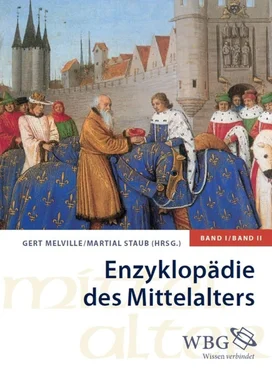
 Universalmächte
Universalmächte Papsttum
Papsttum