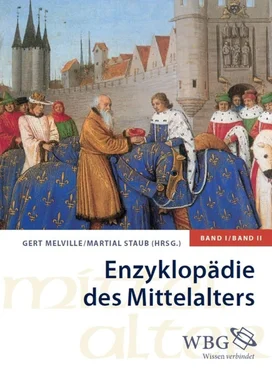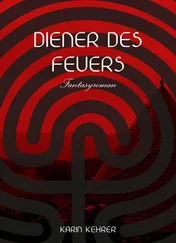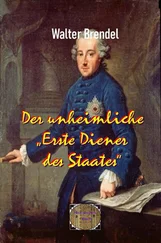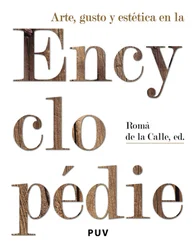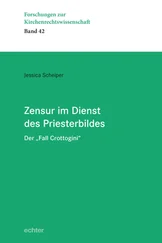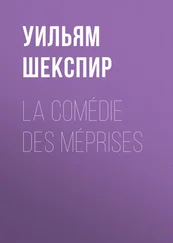Der Austausch zwischen den verschiedenen Fakultäten, in denen über Fragen der Politik diskutiert wurde, war unterschiedlich dicht. Die Theologen verdankten ihrer umfassenden Ausbildung zumeist auch eine vertiefte Kenntnis der Philosophie und des Kirchenrechts. Bei ihnen liefen also gewöhnlich alle Diskussionen zusammen. Die Juristen zeigten sich dagegen länger resistent gegen das Eindringen außerrechtlicher Autoritäten. Erst der berühmteste Jurist des Mittelalters, Bartolus de Sassoferrato († 1357), ließ aristotelisches Gedankengut in seine juristischen Überlegungen einfließen. Die Entstehung einer kontinuierlichen Diskussion über politiktheoretische Fragen wurde jedoch weniger durch die Grenzen zwischen den verschiedenen Fakultäten gehemmt als durch die Schwierigkeiten der Kommunikation im Mittelalter. Wissen wurde durch Handschriften verbreitet und fand daher oft nur wenige Abnehmer. Selbst innerhalb einer Disziplin wie der Theologie hatten bedeutende Gelehrte keine Kenntnis voneinander. So nahmen Marsilius von Padua († 1342/43) und Wilhelm von Ockham († 1347/48) keine Notiz von den früher entstandenen Traktaten Dantes († 1321) und Johannes Quidorts († 1306), obwohl sich die Texte dieser Autoren in mancher Hinsicht ähnlich sind. Erst die Konzilien von Basel und Konstanz im 15. Jahrhundert sorgten für Rezeption und Verbreitung der wichtigsten Abhandlungen zur politischen Theorie. Eine „Gelehrtenrepublik“ im eigentlichen Sinn konnte sich jedoch erst nach der Erfindung des Buchdrucks dauerhaft etablieren.
Neben der Universität spielte der Hof im Mittelalter eine untergeordnete Rolle bei der Herausbildung der politischen Philosophie. Die Gelehrten bemühten sich durch Widmungen politiktheoretischer Abhandlungen, Könige und Fürsten in ihrem Handeln zu beeinflussen und in ihr Patronagenetzwerk aufgenommen zu werden. Manchmal forderten Herrscher selbst die Gelehrten zu wissenschaftlichen Gutachten in Konfliktfällen auf. Besonders im Konflikt mit der päpstlichen Kurie konnten die Könige nicht darauf verzichten, auch ihrerseits an die scheinbar unabhängige Instanz der Gelehrsamkeit zu appellieren. Geballte Intelligenz versammelte Ludwig IV. („der Bayer“) an seinem Hof, als er mit Papst Johannes XXII. im Streit lag. Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham flüchteten zum Kaiser, nachdem sie sich mit dem Papst überworfen hatten. Ihre Wirkung war jedoch beschränkt. Mehr Einfluß auf den Gang der Politik in Deutschland nahm der Jurist Lupold von Bebenburg († 1363), der eine konventionelle kirchliche Pfründenkarriere durchlief und zum Bischof von Bamberg aufstieg. Die Kluft zwischen gelehrter und höfischer Kultur war meist zu groß, als daß die politische Theorie dauerhaft in den Raum des Hofes eindringen konnte.
Ausdifferenzierung der Politik.Die Etablierung eines Nachdenkens über das Feld der politischen Theorie war trotz des antiken Erbes keine Selbstverständlichkeit. Vor dem 13. Jahrhundert vollzog sich die Reflexion zum einen auf der Ebene der Moral in den Fürstenspiegeln [↗ Königtum]; zum anderen diente die Organismusmetapher zur Darstellung des politischen Feldes. Am ausgefeiltesten war die Konzeption des Johannes von Salisbury († 1180) in seinem vielschichtigen Werk Policraticus. Er dachte die politische Gemeinschaft als Körper und identifizierte den König mit dem Haupt, den Senat mit dem Herz, die Richter mit den Sinnen, die Amtleute mit den Händen und die Bauern mit den Füßen. Die innere Harmonie, die Gesundheit des Körpers sei dann gewährleistet, wenn jeder Teil der Gemeinschaft seine Funktion erfülle und sich von der Vernunft leiten lasse. Der Staat wurde von Johannes also mit der ständischen Ordnung identifiziert und quasi als natürliche Entität ausgewiesen, die den einzelnen Menschen nicht zur Disposition stand. Die Organismusmetapher blieb ein attraktives und oft benütztes Denkschema zur Rechtfertigung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, auch wenn nach der Rezeption des Aristoteles der Gedanke der Machbarkeit von Verfassungen zum Durchbruch kam. Die Lektüre des Aristoteles ließ eine Diskussion um die beste Verfassung entstehen, in der die politische Ordnung der kontingenten Entscheidung der Menschen überlassen wurde. Dieser Bruch wurde allerdings dadurch abgefedert, daß man nach Aristoteles weiterhin daran festhielt, daß „die Wissenschaft die Natur nachahmt“ (ars imitatur naturam). Es galt daher als ein passables Argument, wenn man von der monarchischen Organisation der Bienen, vom Königtum des Löwen auf der Erde und vom Königtum des Adlers in den Lüften auf den Vorrang königlicher Herrschaft schloß. Die Kontingenz der Verfassungsdiskussion wurde darüber hinaus durch die Bevorzugung der Mischverfassung in Schranken gehalten. Die meisten Autoren sprachen sich in der Nachfolge des Albertus Magnus († 1280) und des Thomas von Aquin (†1274) für eine Mischung aller Verfassungsformen aus. Damit akzeptierte man, daß der König, der Adel und das Bürgertum nach ständischen Gesichtspunkten in unterschiedlicher Intensität an der Herrschaft teilhaben sollten. Die Repräsentation der ständischen Ordnung dominierte die Entscheidung über die Auswahl der Verfassungsform. Eine Abkehr von dieser Reduktion der Kontingenz des politischen Feldes leiteten erst Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham ein. Marsilius trennte die ständische Gliederung der Gesellschaft radikal vom Aufbau politischer Institutionen. In seiner Sicht der Entstehung des Staates gab es die ständische Gliederung bereits, bevor sich das Volk durch besonders weise Männer zur Etablierung von Institutionen überreden ließ. Die Regierungsform ist dann tatsächlich in die Entscheidung des souveränen Volks gelegt. Ob eine Monarchie, Aristokratie oder Demokratie angemessen ist, obliegt aus der Sicht des Marsilius allein der Mehrheitsentscheidung des Volks. Ockham zog dagegen in seinem in Dialogform verfaßten Hauptwerk alle Sicherheiten der Verfassungslehre in Zweifel. Als Kriterium für die Wahl der Verfassungsform ließ er nur die der historischen Veränderung unterworfene Zweckmäßigkeit gelten. Einen festen Vorrang der Monarchie oder der gemischten Verfassung hielt Ockham angesichts des historischen Wandels für nicht vertretbar. Was als zweckmäßig gelten sollte, könnten dann nur die jeweils betroffenen Menschen herausfinden. Die politische Ordnung erscheint damit nicht mehr als naturgegeben, sondern als kontingent und veränderbar.
Souveränitätsbegriff.Der französische Begriff „souverain“ wurde in politischen Zusammenhängen seit dem 13. Jahrhundert verwendet. Er signalisierte zunächst nur eine relative Überordnung (lat. superior bzw. mlat. superanus), die zum Beispiel auch ein Baron für sich in Anspruch nehmen konnte. Im Lauf des 14. und 15. Jahrhunderts nahm allmählich das Königtum diesen Begriff in Beschlag. Er bezeichnete den König als letzte gerichtliche Appellationsinstanz in Frankreich und wurde folglich auch für die Kennzeichnung anderer königlicher Institutionen verwendet („Souverain Maistre des Eaux et Forêts“). Erst Jean Bodin machte den Begriff der Souveränität zum Schlüsselkonzept der politischen Theorie. Unter Historikern besteht daher Einigkeit, daß die Vorstellung einer einheitlichen letzten Hoheitsgewalt in Justiz, Verwaltung und Politik als eine Errungenschaft der Frühen Neuzeit anzusehen ist. Für das Mittelalter hat F. Kern den Begriff der „Souveränität des Rechts“ geprägt. Kern brachte damit zum Ausdruck, daß in Konflikten nicht der Anspruch auf eine letzte Hoheitsgewalt erhoben wurde, sondern daß sich verfeindete Parteien in je unterschiedlicher Weise auf ein höheres (göttliches oder natürliches) Recht beriefen. Ein klassisches Beispiel ist die Diskussion um die Legitimität von Besteuerung. Bezugspunkt der Argumentation war dabei stets das Gemeinwohl (bonum commune). Steuern galten nur dann als gerechtfertigt, wenn sie dem Gemeinwohl dienten oder einem Notstand (necessitas) Abhilfe schaffen sollten. Dem König wurde somit kein Obereigentum an den Gütern der Bevölkerung zugesprochen, sondern sein Zugriff durch Besteuerung beruhte auf der naturrechtlichen Maxime, daß Eigentumsrechte im Notfall suspendiert werden könnten. Wo konkret die Grenzen des königlichen Zugriffsrechts gezogen werden sollten, wurde durch die historische Situation, durch das Verhandlungsgeschick des Königs und der Stände, entschieden.
Читать дальше