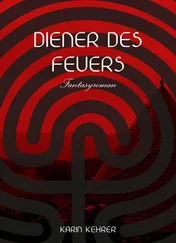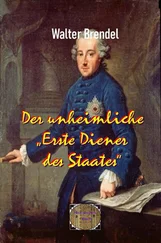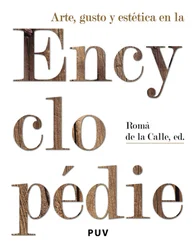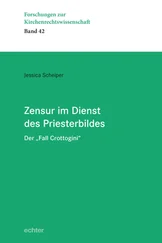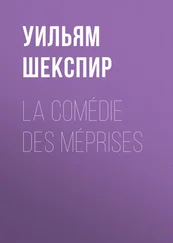Im Spätmittelalter hatte ein König [↗ Königtum; ↗ Königsherrschaft] immer noch eine herausgehobene Stellung innerhalb der Kirche, jedoch war er nicht selbstverständlicher Teil der kirchlichen Amtshierarchie. Umgekehrt hatten Bischöfe und Prälaten wohl eine sichtbare Rolle in der poltischen Repräsentation des Landes zu spielen (wie etwa die deutschen Fürstbischöfe). Auch sie aber mußten ihre politischen Entscheidungen institutionell in anderen Bezügen finden und durchsetzen als im engeren Kreis des Klerus. Hatte zunächst den König die ihm zugeschriebene sakrale Aura dem Adel des Reichs tendenziell entrückt, so hat die Amtskirche sich seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts mehr und mehr als Klerus selber von dem christlichen Volk abgehoben und damit von den Laien abgegrenzt.
Zugleich nahm die Amtshierarchie sich selbst immer stärker als Kern und Spitze der (Amts-) Kirche wahr. Papst und Kurie wuchsen zu wirklichen Zentren der kirchlichen Organisation, zwar mit einem den Umständen entsprechend sehr spezifischen Instrumentarium von Bürokratie und Kommunikationstechnik, aber mit ungeahnter und wegweisender Effizienz, vor allem mit vorbildhafter finanzieller Durchschlagskraft. Der König jedoch wurde zunehmend entzaubert. Er galt seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts als „Laie“ und blieb damit Geistlichem fremd; unmittelbare Eingriffe in geistliche Belange blieben ihm verwehrt [↗ Investiturstreit]. Das schloß nicht aus, daß seine Herrschaft aus göttlichem Auftrag abgeleitet wurde, aber diese Herkunft mußte zum Thema erbitterter Auseinandersetzungen werden: War ein unmittelbarer Gottesbezug des Herrschers an der kirchlichen Organisation vorbei denkbar? Konnte, ja mußte nicht ein derartiger Auftrag von der Papstkirche vermittelt werden? Wie aber verhielt sich dann das politische Gemeinwesen zu Interferenzen der Amtskirche?
Die Antworten auf diese Fragen waren höchst unterschiedlich. Formulierten die einen den kirchlichen Anspruch in absolutistischer Strenge, die der weltlichen Gewalt kein eigenständiges Lebensrecht mehr ließ, so konnten andere Positionen fast gleichzeitig die gesamte Kirche im staatlichen Gemeinwesen verschwinden lassen. Daneben fehlte es auch nicht an Vermittlungsversuchen. Solche Differenzen beflügelten aber, unabhängig von den konkreten Aussagen der einzelnen Theorie, letzten Endes die Freiheit der politischen Entscheidung. Die Emanzipation weltlicher Herrschaftsübung und die Säkularisation der politischer Verfassung machten im Spätmittelalter unverkennbare Fortschritte. Was in der Kirche begonnen hatte, verallgemeinerte sich. Die „Entzauberung der Welt“ machte beim König keineswegs halt und ergriff die gesamte Gesellschaft. Das Mittelalter hat diese Entwicklung nicht selber voll abgeschritten; in ihren Debatten haben die mittelalterlichen Positionen jedoch die Moderne geprägt und grundgelegt. Das Mittelalter ist selbst ein unaufgebbarer Teil der freiheitlichen Gesellschaftsgeschichte Europas.
JÜRGEN MIETHKE
 Herrschaft
Herrschaft
Begriff.„Herrschaft“ ist eine Schlüsselkategorie der deutschsprachigen Mediävistik. Man spricht von Königs-, Bischofs-, Kirchen-, Stadt-, Lehens-, Gerichts- und von Grundherrschaft und will damit spezifisch mittelalterliche Phänomene charakterisieren. Die Bedeutung, die man diesem Begriff unterlegt, ist schwankend und war in der Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts umstritten. In den letzten Jahren gewinnt die soziologische Definition M. Webers an Boden. Nach Weber ist Herrschaft „die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“. Diese Definition beschränkt sich formal auf das institutionell verfestigte Verhältnis von Befehl und Gehorsam und sagt nichts über die Grundlage bzw. die Legitimität des Erwerbs von Herrschaft aus. Ihr entgegengesetzt ist die Auffassung O. Brunners, die lange Zeit die mediävistische Forschung geprägt hat. In seinem verfassungsgeschichtlichen Klassiker Land und Herrschaft (1939) lehnte Brunner die Anwendung moderner Begriffe (wie insbesondere das Konzept des Staates und der Gesellschaft) ab und forderte den Rückgriff auf eine quellennahe Begrifflichkeit. Der schon im Mittelalter nachweisbare Begriff der „Herrschaft“ schien dieses Kriterium zu erfüllen. Für Brunner (und andere einflußreiche Historiker wie H. Dannenbauer und W. Schlesinger) standen die Herrschaftsrechte des Adels am Beginn der mittelalterlichen Geschichte und wurden erst langsam durch die Herausbildung einer öffentlichen Rechtsordnung in ihrer Legitimität eingeschränkt. Königsherrschaft erwies sich dann als ein Sonderfall der autogenen (das heißt ursprünglichen) aristokratischen Herrschaft. Dieses Modell wurde bis zur Ableitung aller Gewalt aus der Stellung des Hausvaters über Familie und Gesinde gesteigert. Herrschaft faßte Brunner dabei nicht wie Weber neutral auf, sondern als ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Verhältnis. Es ist definiert durch die einander ergänzenden Normen von „Treue und Huld“, „Schutz und Schirm“ bzw. „Rat und Hilfe“: So wie der Untergebene zu Rat und Hilfe verpflichtet gewesen sei, habe der Herrschende Schutz und Schirm gewährleisten müssen. Diese Normen prägten nach Brunner die Herrschaft auf allen Ebenen: die Grund-, Stadt-, Lehens- und Landesherrschaft. An diesem Modell wurde von verschiedenen Seiten Kritik geübt. Zum einen wurde darauf hingewiesen, daß das mittelhochdeutsche herscap erst im Spätmittelalter nachweisbar ist und in seiner Begriffsentwicklung durch das Bedeutungsspektrum der lateinischen Äquivalenzbegriffe entscheidend beeinflußt wurde. Auch die Begriffe der „Treue“, der „Huld“ und des „Schirms“ löste man aus Brunners ausschließlicher Einbettung in das germanische Rechtsdenken heraus und setzte sie in Bezug zur christlichen und römischen Tradition. Zum anderen geriet Brunners Idealisierung mittelalterlicher Herrschaftsverhältnisse in die Kritik. Die Umschreibung von Herrschaft als auf Gegenseitigkeit beruhendes Sozialverhältnis wurde als zeitgenössische Ideologie der Adelswelt entlarvt, die Ausübung und Androhung nackter Gewalt verdecken sollte. Als Folge dieser Kritik ist man weitgehend zu einer neutralen Verwendung des Herrschaftsbegriffs zurückgekehrt, wie er seit M. Weber in der Soziologie vorherrscht. Als solcher bewährt er sich weiterhin als Schlüsselbegriff für die Epoche vor der Herausbildung des modernen Staates: Der Begriff „Herrschaft“ betont durch den Bezug auf einen „Herrn“ das persönliche Element mittelalterlicher Politik; er macht daher auf das stets ungesicherte, labile und prekäre Verhältnis zwischen Befehlsgeber und Befehlsempfänger aufmerksam; er spiegelt zudem die fehlende bzw. nur in Ansätzen vorhandene Trennung zwischen öffentlicher und privater Gewaltausübung, zwischen öffentlichem Recht und persönlichen Rechten; und er insinuiert die Einbettung der politischen Ordnung in die parallel konstruierte gesamtgesellschaftliche Stratifikation, die auf allen Ebenen (von Gott bis zum Grundherrn) einen dominus kannte. Besonders im frühen und hohen Mittelalter hat daher der Begriff der „Königsherrschaft“ weiterhin eine hohe Konjunktur. Die Ottonenzeit bezeichnet G. Althoff als eine „Königsherrschaft ohne Staat“. Für eine qualifizierte Form der politischen Herrschaft hat sich die Prägung „konsensuale Herrschaft“ (B. Schneidmüller) als fruchtbar erwiesen. Vor dem Hintergrund der geringen Institutionalisierung von Herrschaft hat die Einforderung, Inszenierung und Vorspiegelung von Konsens die politische Entscheidungsfindung maßgeblich geprägt.
Legitimation.Im Gegensatz zur Antike stand Herrschaft im christlichen Mittelalter stets unter Legitimationszwang. Wie man sich das Leben im Paradies auch immer vorgestellt hat, unbestritten war die Tatsache, daß Königtum und Adel keinen Platz im ursprünglichen göttlichen Schöpfungsplan hatten. Der Urzustand kannte kein Eigentum, keine Herrschaft, keine Knechtschaft. Die Entstehung dieser Institutionen ist in der Bibel eindeutig negativ besetzt. Auf die Verfluchung Kanaans durch Noah (Gen 9,25) wurde im Mittelalter die Knechtschaft zurückgeführt, auf Nimrod, den „Jäger wider Gott“ (Gen 10,9), die Etablierung der Herrschaft über ein Reich. Das Ideal einer herrschaftsfreien Zeit galt allerdings dem Mittelalter als unwiederbringlich verloren. Seit Augustinus stand in der lateinischen Theologie fest, daß der Sündenfall Adams und Evas eine Kluft zwischen dem geschaffenen und dem gefallenen Menschen aufgerissen hat [↗ Christliches Menschen- und Gottesbild]. Die Erbsünde habe den menschlichen Willen grundlegend verändert und auf das Böse ausgerichtet. Herrschaft galt seither unbestritten als notwendig; selbst im Kloster, das doch vorgab, durch Askese und Frömmigkeit einen Abglanz des Paradieses zurückzugewinnen, herrschte ein Abt mit monarchischer Vollmacht. Der herrschaftsfreie Urzustand sollte nicht Herrschaft prinzipiell in Frage stellen, sondern diente dazu, alle Träger von Herrschaft an die ursprüngliche Gleichheit zu erinnern und Milde sowie Demut gegenüber den Untertanen einzufordern. Nur vereinzelte häretische Gruppen versuchten das Ideal des herrschaftsfreien Urzustands wieder zum Leben zu erwecken, wobei manchmal unklar bleibt, ob sie dieses Ideal tatsächlich angestrebt haben oder ob es ihnen nur von der Inquisition unterstellt worden ist (sogenannte „Adamiten“).
Читать дальше
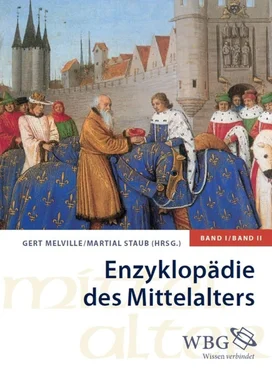
 Herrschaft
Herrschaft