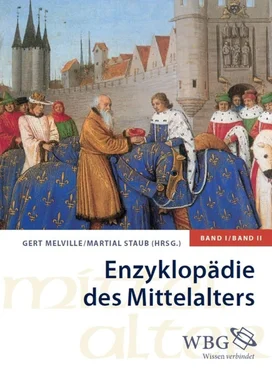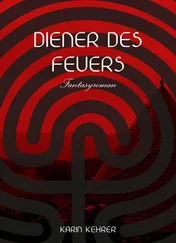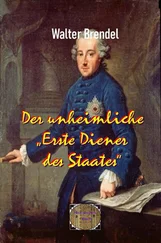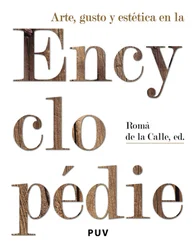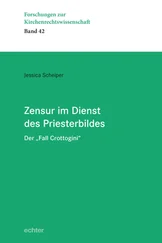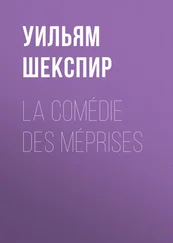Die Warenströme kreuzten sich auffällig in der Champagne. Die Städte dort hatten davon den Nutzen und wußten ihn wahrzunehmen. Die „Messen“ der Champagne wurden nicht allein zu einem frühen Umschlagplatz des Fernhandels; man begann dort auch vorbildhaft die Instrumente des Waren- und Geldverkehrs zu entwickeln, die für den europäischen Handel noch jahrhundertelang maßgeblich bleiben sollten. Die sich entfaltende Geldwirtschaft [↗ Geld] erhielt frühzeitig Kreditinstitute; sie schuf sich, an den kirchlichen geldfeindlichen Traditionen des Zinsverbotes vorbei, flexible und rentable Werkzeuge und entwickelte sie fort. Mit Terminkäufen und Geld- wie Warenanweisungen auf einen bestimmten Platz wurde in Ansätzen hier relativ früh der Weg zum „Wechsel“ beschritten, der sich bald als Lenkungsinstrument als griffig erwies, was sich dann auch Kirche und Staat zunutze machten. Ein bargeldloser Zahlungsverkehr über weite Entfernungen und über zahlreiche Landesgrenzen hinweg, der auch der avignonesischen und dann wieder römischen Kurie des Papstes und ihrem Finanzbedarf früh zugute kam, ein immer flexibler ausgestattetes Kreditsystem, all das wurde Schritt für Schritt entwickelt und ausgebaut.
Soziale Prozesse.Die zunehmende Durchdringung des Raumes läßt die Regionen Europas zusammenrücken. Das Straßennetz verdichtet sich; die Menschen setzen sich in Bewegung, nicht nur als einzelne, sondern in großer Menge: Schiffe, Handelswagen, Siedlertrecks, Pilgerzüge, Wallfahrer, Handwerksgesellen, Kreuzfahrer, große und kleinere Heereskontingente durchmessen den Raum [↗ Verkehr]. Von den theologischen Zeitgenossen wird der Mensch in seinem Erdenleben, in Aufnahme und Fortsetzung eines altchristlichen Bildes von der Erdenpilgerschaft zunehmend als homo viator bezeichnet [↗ Christliches Gottes- und Menschenbild]. Auch für die sozialen Verbände brachten die neuen Erfahrungen eine neue Beweglichkeit. Dem Druck der Verhältnisse konnte man jetzt leichter ausweichen, konnte anderwärts sein Glück suchen und finden. Die deutsche Ostsiedlung [↗ Osteuropäischer Raum], die spanische „Reconquista“ mit der „Repoblación“ setzte Menschen in Bewegung [↗ Iberischer Raum]. All dies kommt im späteren Mittelalter zu voller Entfaltung. Die horizontale Mobilität bringt soziale Lockerung. Sie begünstigt eine „vertikale“ soziale Mobilität. Soziale Mobilität heißt jedoch immer beides; sie bringt Aufstiegschancen und Abstiegsgefahren. Der Möglichkeit für die einen zu steigen entspricht die Bedrohung der anderen mit mehr oder minder tiefem Fall. So hilft horizontale Mobilität den sozialen Status für den einzelnen wie für ganze Gruppen zu verändern, für Familien, Personenverbände und lockerere Gruppierungen. Man sucht, zur Absicherung und zur Bändigung der Kräfte der Veränderung neue Ordnungen und Formationen und findet sie, bisweilen erfolgreich für künftige Jahrhunderte [↗ Soziale Formationen]. Jetzt werden Muster künftiger Strukturen zumindest in den Grundzügen festgelegt. Europa ist in einer formativen Phase.
Diese Differenzierungs- und Umschmelzungsprozesse, die die frühmittelalterliche Sozialordnung umwandeln, sind begleitet von einer deutlichen Tendenz, die (teilweise neuen) Statusgruppen in sich selbst zu vereinheitlichen, sie nach unten hin abzuschirmen, zur Sicherung vor jähem Absturz. Solche Tendenzen zeigen sich in Deutschland etwa im Reichsfürstenstand, im hohen und im niederen Adel, in der Ministerialität, im sogenannten Patriziat der Städte. Sie bezeugen weniger die Stabilität der hergebrachten Ordnung, als daß sie Bemühungen spiegeln, im Fluß der Entwicklung Fixpunkte und Halt zu gewinnen. Besonders markant tritt die Tendenz zur Selbstabschließung und Konsolidierung bei den Neubildungen in Erscheinung; sie findet sich am auffälligsten bei Aus- und Abgrenzung des Adels gegenüber den anderen Landbewohnern. Je mehr sich die milites als Berufskriegerschicht seit dem 11. und 12. Jahrhundert als einheitliche Gruppe etablieren [↗ Adel], desto deutlicher tritt ihnen auch die Bauernschaft als sich homogenisierende Gruppe gegenüber [↗ Bauerntum]. Aus einer ständisch sehr ungleich zusammengesetzten Schicht wird in beiden Fällen ein „Stand“ der Gesellschaft mit durchgängigen Merkmalen, auch rechtlichen. Der ältere Gegensatz zwischen servus und liber wird zwar nicht aufgegeben. Deutlicher im Vordergrund des Interesses steht aber der Unterschied von rusticus und miles. Rustici sind nicht mehr waffenfähig, werden des Schutzes bedürftig. In den Gottesfrieden [↗ Gottesfriede, Landfriede] des 10. und 11. Jahrhunderts, in den Landfrieden seither werden sie einem Sonderschutz unterstellt. Für den rusticus sind Ochsen und Pflug, labor (schwere Handarbeit) und paupertas Assoziationsfelder, für den miles Pferd und Schwert, die negotia belli und divitiae.
Selbstabgrenzung und Spezialisierung des sogenannten „niederen Adels“ hatten auch Folgen für den Lebensstil und den Lebenskreis dieser Schicht [↗ Adel]. Auch hier kommt es zu einer topographisch sichtbaren Separierung des Adelssitzes von den bäuerlichen Siedlungen, der als Höhenburg (bzw. Wasserburg) zur charakteristischen Wohnstätte wird. Seit dem 11. Jahrhundert ist der Übergang vom Herrenhof auf die Adelsburg im Gang und erreicht im 13. und 14. Jahrhundert immer breitere Dimensionen. Je wichtiger Befestigungsanlagen für die Herrschaftssicherung wurden, desto höheren Wert gewann auch der Besitz einer Burg. Die Befestigung wurde zum Statussymbol und zur Bedingung des Statuserhalts zugleich. Durch den Umzug in die adlige Höhenburg wird sichtbar – mit immensen Anstrengungen und Kosten – Distanz gewonnen und dargestellt. War eine Burg aber einmal gebaut, entstand das Problem herrschaftlicher Integration in die fürstliche Hoheit. Zuordnung und Einordnung „fremder“ Befestigungen in die eigene Herrschaftssphäre blieb für die sich konsolidierenden Herrschaftsbildungen eine dauerhafte Aufgabe. Keineswegs konnte sie überall durch lehnsrechtliche Eingliederung gelingen [↗ Lehnswesen; ↗ Feudalrechte]. Mit dem jeweiligen Landesherrn konkurrierten nicht nur andere Fürsten, Bischöfe und benachbarte Vasallen; auch die Städte traten auf den Plan, wenn sie sich einen größeren Herrschaftsbereich sichern wollten. Burgen, die man nicht unmittelbar in die eigene Hand bekam, konnte man in vielfacher Abschattierung von sich abhängig machen. Eine dauerhafte Zuordnung bei Wahrung rechtlicher Selbständigkeit boten die vielfältigen sogenannten „Öffnungsverträge“ des Spätmittelalters, mit denen der burgsässige Adel für den Fall militärischer Konflikte in herrschaftliche Verfügungskompetenz eingebunden werden konnte. Im Falle einer Bedrohung „öffnete“ der Burgbesitzer seine Fortifikation dem Fürsten oder der Stadt. Auch die adlige Einzelburg entging damit dem Prozeß der Herrschaftskonzentration nicht auf Dauer.
Während die Abschließung des niederen Adels durch Vertiefung der Gräben zu den rustici in der Regel schon im 12. Jahrhundert zum Erfolg führte, verschwanden die Zäune zwischen Ministerialität und Adel wenig später: Die militia, das berufsständische Element, das eine Brücke gebildet hatte, konnte später zurückgedrängt werden, „Ritter“ wird man dann durch Geburt. Schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wird Ritterbürtigkeit als Voraussetzung für den „Ritterschlag“ deklariert, früh etwa in den Konstitutionen von Melfi (1231).
Die Abschließung des Adels bedeutete gewiß auch Sicherung der materiellen Grundlagen des eigenen Lebensstils. Tendenziell hieß das auf längere Sicht zudem eine quantitative Reduktion der Adelsschicht, da eine Ergänzung der durch Aussterben oder Verarmung ausscheidenden Familien jetzt schwieriger wurde [↗ Verwandtschaftliche Ordnungen]. Das hohe Lebensrisiko des Berufskriegerstandes gefährdete die biologische Kontinuität der agnatischen Linie, auf die der Erbgang jetzt konzentriert wurde. Eine schwierige Balance bei der Familienplanung mußte dafür sorgen, daß einerseits genügend männlicher Nachwuchs vorhanden war, um eine Fortsetzung der Generationenreihe zu ermöglichen. Andererseits waren natürlich auch zu viele Geschwister, die zu versorgen waren, problematisch. Seit dem 12. Jahrhundert lassen sich daher verschiedene Steuerungsstrategien in diesem Dilemma erkennen: man konnte durch eine Akzentuierung des Erbrechts, die dem Ältesten (oder dem Jüngsten) den grundherrschaftlichen Gesamtbesitz der Familie zuwandte und die Geschwister anders, das heißt finanziell, abfand, eine gewisse Bremswirkung erzielen [↗ Verwandtschaftliche Ordnungen]. Andererseits konnte die brüderliche Gesamthand durch entsprechend vorgeschriebenes Heiratsverhalten in ihrem Bestand geschützt werden. Schließlich konnte man auch die Kirche als Versorgungsinstitut heranziehen, die ihren Klerus seit dem 11. Jahrhundert verstärkt zum Zölibat verpflichtete (was zumindest legitimen Nachwuchs ausschloß, aber günstige Wirkungen kirchlicher Unterstützung öffnete) [↗ Klerus]. Bei einem drohenden Aussterben einer Familie des Hochadels wurde eine kirchliche Karriere nicht selten durch die Rückkehr in den Laienstand abgebrochen. Daß der Kandidat die Priester- oder Bischofsweihe noch nicht erhalten haben durfte, schränkte den Kreis möglicher Begünstigter nicht allzustark ein, da ohnedies der Empfang der höheren Weihen von adligen Klerikern im Spätmittelalter nicht gerade vordringlich betrieben wurde.
Читать дальше