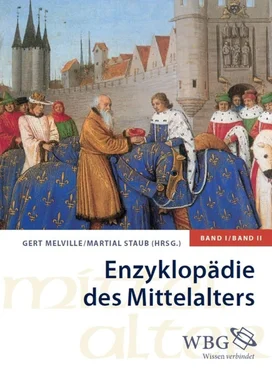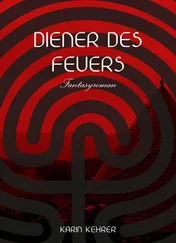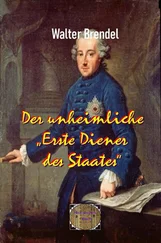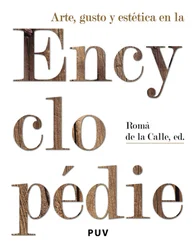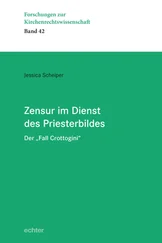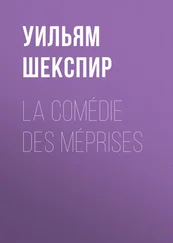In Kerneuropa hat die Bevölkerung seit dem 7. Jahrhundert bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts kontinuierlich mit explosiven durchschnittlichen Wachstumsraten (von jährlich 1 % bis 2 %!) zugenommen, der hohen Mortalitätsrate wie der geringen durchschnittlichen Lebenserwartung zum Trotz. Das mittelalterliche Europa hatte eine „jugendliche“ und wachsende Bevölkerung. Am Ende der Wachstumsphase hatte sich die Menschenzahl bis auf das etwa Sechsfache der Ausgangsgröße gesteigert. Im einzelnen freilich muß man dieses globale Bild sowohl regional als auch nach Zeitabschnitten wesentlich differenzieren. Allein die Hungerkrisen bei Mißernten (wie zu Beginn des 14. Jahrhunderts), Naturkatastrophen, Kriegswirren, Krankheiten und Seuchenzüge führten zu einem örtlichen, regionalen und – im äußerst seltenen Extremfall – auch allgemeinen punktuellen oder dauerhaften Absturz der Wachstumslinie. Der „Schwarze Tod“ (Beulenpest), der um die Mitte des 14. Jahrhunderts selektiv, aber doch weiträumig bis zu einem Drittel der Menschen dahinraffte und seither bis ins 18. Jahrhundert Europa immer wieder heimsuchte, sorgte für einen allgemeinen demographischen Einbruch [↗ Heilkunde und Gesundheitspflege]. Gleichwohl begann unmittelbar im Anschluß daran eine neue Konsolidierung der Bevölkerung und ein weiteres Wachstum, das zwar die alte Höhe bis zum Ende des Mittelalters kaum erreichte, jedoch die Lücke wieder auffüllte.
Die positive Dynamik war regional von Schwankungen begleitet, die dem hohen Zuwachs an Lebens- und Wirtschaftskraft auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen im Wege standen. Wachstumskrisen sorgten je und dann dafür, daß immer wieder die „gute alte Zeit“ Lobredner fand. Gleichwohl füllte sich das Land immer stärker mit Menschen; die Dichte der Besiedlung nahm in zuvor ungeahntem Maße zu. Rodung der Wälder, Besiedlung des Ödlandes, Vermehrung der landwirtschaftlichen Produktion [↗ Ländlicher Raum] sind ein allgemeines Phänomen, wenngleich es mit exakten Zahlen hier ebenfalls nicht gut steht. Der früh- und hochmittealterliche „Landesausbau“, der immer neue Flächen in Nutzung nahm, bis die weiteste Ausdehnung des Ackerbaus im späteren Mittelalter durch Umsiedlungen und Wüstungsvorgänge fast überall in Europa wieder eingeschränkt werden mußte, die Differenzierung von ländlichen Regionen, all das sorgte für weitere Aufnahmefähigkeit. In den zentralen Städtelandschaften Europas [↗ Städtischer Raum], in Norditalien, Südfrankreich, am Nieder- und Oberrhein drängten sich bald immer mehr Menschen. Die Quote der Stadtbewohner konnte am Niederrhein bereits im 15. Jahrhundert etwa ein Drittel, in einigen herausgehobenen Bezirken an der Wende zum 16. Jahrhundert sogar fast 50 % erreichen. Für das Herzogtum Brabant hat (1435) eine Feuerstellenzählung 92.418 Feuerstellen notiert, was auf etwa eine halbe Million Menschen schließen läßt. Demnach ist hier eine Dichte von bis zu 45 Menschen je Quadratkilometer anzunehmen. Für das Bistum Posen hat man dagegen für das Spätmittelalter weniger als ein Zwanzigstel dieses Wertes (2,1) ausgemacht. Im Gebiet des Deutschen Ordens zählte man im Kulmerland etwa 25 Menschen pro Quadratkilometer, in der Komturei Christburg nur etwa halb so viele.
Derartige Differenzen können keineswegs allein aus „natürlichen“ Unterschieden herrühren. Sosehr das Mittelalter die Menschen in kleinräumigen Regionen einband, ja gefangenhalten konnte, eine solch weitgespreizte Häufigkeitsverteilung ist ohne starke Wanderungsbewegungen nicht zu verstehen. Zu dem (wechselhaften) Druck der Bevölkerungsvermehrung tritt Fluktuation durch Migrationen, die freilich nicht ausschließlich weite Entfernungen großräumig durchmaßen. Die Kreuzzüge [↗ Kreuzzüge] exportierten sogar Menschen für längere Zeit über den vorherigen Rand der eigenen Welt hinaus. Auf Migrationen mußten die Menschen reagieren, sie konnten als Bedrohung oder als Chance erfahren werden, ja als beides zugleich. Die stabilitas loci, die einem Benediktinermönch abverlangt wurde [↗ Klösterlicher Raum], war eine kontrastive Idealforderung, die keine Allgemeingültigkeit besaß. Sie setzt vielmehr Wandern geradezu als Normalfall voraus. Die Grundstruktur der mittelalterlichen Gesellschaftsbildung ist also von Dynamik geprägt, nicht von Stillstand und Beharrung.
Wirtschaftlicher Rahmen.Bedingung und Folge der demographischen Dynamik war eine zuvor nicht gekannte Steigerung der agrarischen Produktion. Durch Ausdehnung der bewirtschafteten Flächen und durch Verbesserung der Produktionsbedingungen Nahrung für die Menschen zu gewinnen, war eine Aufgabe, die nicht ohne allseits gewaltige Anstrengungen lösbar wurde. Das Mittelalter ist eine Zeit der extensiven und intensiven Ausweitung des Ackerbaus und innovativer Wirtschaftsleistungen. Der „Landesausbau“ seit der Karolingerzeit [↗ Sozialräume], technische Erfindungen, Innovationen im gewerblichen und häuslichen Leben [↗ Praxis der Technik] zeigen die Menschen anpassungswillig und anpassungsfähig.
Die technische Verbesserung der Arbeitsgeräte war begleitet von Verbesserungen der Transporttechnik [↗ Transport und Verkehr]: Die Ausbreitung vierrädriger Wagen, die Verbesserung der Anschirrtechnik ermöglichten einen erhöhten Einsatz tierischer Energie. Eisen gewann zunehmend Anteil am bäuerlichen Arbeitsgerät, nicht nur beim Pflug, auch bei Sichel oder Sense, auch dem Spaten, der schon im Mittelalter den „Grabstock“ oder das „Grabscheit“ abzulösen beginnt [↗ Agrartechnik].
Verbesserungen des Werkzeugs begünstigten und erzwangen auch Änderungen in der Arbeitsorganisation. Das konnte sich mit tiefgreifenden sozialen Wandlungen verschwistern [↗ Bauerntum]. Allein, daß sich der schwere Räderpflug von einer Mehrzahl von Rindergespannen besser durch die Ackerflur ziehen ließ, legte einen Verbund der Arbeit nahe und machte ihn zugleich möglich. Wie weit dabei herrschaftliche Organisation, wieweit genossenschaftliche Kooperation eingriffen, entzieht sich unserer Kenntnis. Demgemäß streitet die Forschung hartnäckig um ein angemessenes Verständnis. Der durch die sogenannte „Dreifelderwirtschaft“ hervorgerufene Umbruch läßt sich in seinem Hergang nicht mehr im einzelnen verfolgen, nur in seinen Ergebnissen und in seiner Bedeutung für das Leben ermessen [↗ Landwirtschaft].
Intensivierung hatte ihren gesellschaftlichen Preis. Die neue Technik der Bewirtschaftung erzwang auch eine Disziplinierung der Dorfgemeinschaft, da die Arbeit witterungsbedingt in einem sehr schmal bemessenen Rhythmus erledigt werden mußte. Auch konnte der regelmäßige Fruchtwechsel nicht in Streulage der Einzelfluren gelingen. So begegnen wir in Verbindung mit der Dreifelderwirtschaft einer „Verzelgung“ der Dorffluren, in der durch Flurzwang der Fruchtwechsel geregelt wurde. Die Dreifelderwirtschaft setzt also einen hohen (höheren) Grad sozialer Organisation voraus, und sie erzwingt ihn auch.
Die Relation von Land- und Stadtbewohnern veränderte sich. Während in der Antike 8 bis 9 Landbewohner auf einen Bewohner in der Stadt kamen, waren es im Mittelalter schließlich (trotz Neusiedlung und Waldrodung) nur noch 4 bis 5. Die agrarische Produktivität ermöglichte ein größeres Gewicht der gewerblichen (städtischen) Produktion. Stadt und Land traten in fließenden Übergängen in ein neues Verhältnis [↗ Sozialräume]. Der stete Bevölkerungsdruck mündete in die langdauernden Prozesse der Stadtentstehung, Stadtgründung, Stadtentwicklung [↗ Städtische Genossenschaften]. Das 13. und 14. Jahrhundert hatten hier eine akzentuierte Rolle zu spielen. Der steile Anstieg der Bevölkerungszahl bedeutete nicht allein eine pure Vermehrung der Siedlungen; er führte vielmehr zugleich zu einer Binnendifferenzierung der Bevölkerung, zu neuen, urbanen Strukturen. Die Siedlungsbewegung setzte bereits im 9. Jahrhundert ein, verstärkte sich dann, um später fast überall das Bild zu bestimmen. Die Initiative zur Gewinnung neuen Siedellandes konnte wiederum von verschiedenen Seiten ausgehen, von den Bewohnern eines Siedelraumes gemeinsam, von einer Grundherrschaft, die ihre Besitzungen intensiver zu nutzen hoffte. Somit scheint für den mittelalterlichen Landesausbau beides verantwortlich, genossenschaftliche Anstrengung vieler und herrschaftlicher Ordnungswille einzelner; beides wirkte hier ineinander.
Читать дальше