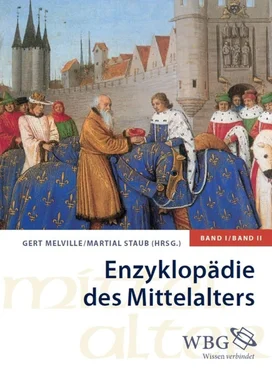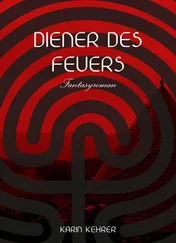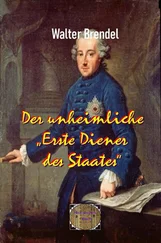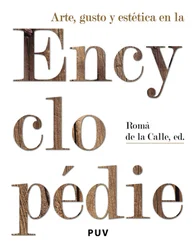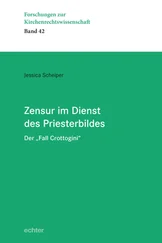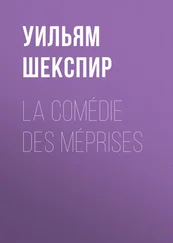Eine Enzyklopädie hat als Grundprinzip immer den Bezug des einzelnen auf ein Ganzes. In den meisten Fällen bleibt das Ganze, auf das sich die einzelnen Artikel beziehen, freilich abstrakt. Anders verhält es sich mit der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS, die als thematische Übersicht der Geschichte des europäischen Mittelalters gelesen werden kann. Gleichwohl kommt die ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS zunächst als ein Nachschlagewerk über Einzelaspekte des europäischen Mittelalters daher. Die Herausgeber müssen sich folglich Rechenschaft darüber ablegen, wie das einzelne in dieser Enzyklopädie auf das Ganze bezogen wird. Damit werden die Hauptmerkmale der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS angesprochen.
In ihrer Anlage ist die ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS:
Das thematische Ordnungsprinzip der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS wird auf dreifache Weise dekliniert:
– Die Einzelartikel folgen einer thematischen Hierarchie. Sie spiegelt sich in den Staffelungen des Inhaltsverzeichnisses und der Kolumnentitel wider. Ihre Leitgedanken werden im Folgenden erläutert.
– Verweise zwischen den Artikeln stellen Querverbindungen jenseits der thematischen Anordnung her. Dabei wird behutsam vorgegangen, um den Textfluß nicht zu zerreißen. Allerdings soll gerade durch die relativ geringe Zahl der Verweise auch die strukturierende Qualität von Vernetzungen, die sich oft zwischen scheinbar weit auseinanderliegenden Aspekten einer Materie spannen lassen, hervorgehoben werden. Ein alphabetisches Register sämtlicher Artikel ermöglicht die rasche Querung der systematischen Gliederung.
– Dem Leser wird mit der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS in Buchform gleichzeitig eine elektronische Kopie zur Verfügung gestellt, damit er durch Volltextsuche eigene Verbindungen erstellen kann. Dies wird nicht nur die schlichte Funktion eines Registers in komplexer Weise erfüllen, sondern es können damit auch Phänomene sichtbar werden, denen kein eigener Abschnitt gewidmet wurde, die indes im Aggregat mehrerer Behandlungsstellen jeweils eigene Konturen gewinnen.
Die thematische Systematik hat forschungsprogrammatische Gründe. Während die Ereignisgeschichte in den jeweiligen Regionen Europas im achten und letzten Abschnitt umrissen wird, werden in den sieben vorangehenden Abschnitten Strukturen und Entwicklungen dargestellt, die einerseits vergleichbar genug sind, um eine einheitliche europäische Perspektive zu rechtfertigen, und die andererseits aber aufgrund ihrer Unterschiede Hinweise auf die Dynamik der Geschichte Europas im Mittelalter und ihre Faktoren geben. Mit der hiermit umrissenen vergleichenden Perspektive ist eine grundsätzliche Hinterfragung der Bedeutung des Nationalstaates für die Geschichte des Mittelalters verbunden. Der sich am Ende des Mittelalters entwickelnde Nationalstaat wird – auf der Gegenstandsebene – als eine Form der politischen Organisation unter vielen betrachtet. Im übrigen wird damit eine bessere Vergleichbarkeit der europäischen Gesellschaft mit den sie umgebenden Gesellschaften erreicht. Es wird dabei die Wichtigkeit des Nationalstaates für die Geschichte Europas und der Welt in der Moderne keineswegs bestritten. Das Gewicht nationaler Traditionen ist in etablierten Disziplinen wie der Mediävistik bis heute spürbar. Im Zeitalter der Globalisierung ist ein Vergleich der Fragestellungen daher besonders dringend. Diese Forderung hat Marc Bloch 1928 auf dem Internationalen Historikerkongreß in Oslo formuliert. Indem sie die Bedeutung des Nationalstaates auch im Hinblick auf historische Fragestellungen hinterfragt, stellt sich die ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS bewußt der mit unerhörtem Elan und großer Weitsicht vor achtzig Jahre formulierten Herausforderung des französischen Mediävisten.
Der Gegenstand der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS leitet sich von einer an Bloch orientierten komparatistischen Perspektive ab. Es handelt sich also um einen Forschungsgegenstand und nicht um ein unabhängig von der Arbeit der Mediävisten existierendes Objekt. Allerdings sahen sich schon die ersten Humanisten gerne als von ihren eigenen Zeitgenossen abgesondert und diffamierten all das, was in ihrer Gegenwart nicht zu ihren Vorstellungen paßte, als dem „Mittelalter“ zugehörig. Seitdem hat sich die Illusion eines abgegrenzten Mittelalters, das anders sei als die Moderne, ob unter negativen oder – wie seit der Romantik immer wieder – unter positiven Vorzeichen, nicht selten, wenn auch nicht ausschließlich, unter Gelehrten gehalten. Die komparatistische Perspektive, die der Enzyklopädie zugrunde liegt, verbindet sich also mit dem klaren Bewußtsein ihrer Autoren, daß ihr Gegenstand konstruiert ist. Doch liefe der reflektierte Umgang der Mediävistik mit ihrer eigenen Tradition Gefahr, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, wenn ihre Vertreter dabei nicht gleichzeitig an eine kritische Öffentlichkeit appelierten.
Der interessierten Leserschaft wird nicht entgehen, daß jegliche Themenauswahl beliebig ist. Die in der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS getroffene Auswahl gehorcht einer forschungsund darstellungspragmatischen Logik, die im Folgenden dargelegt wird.
Enzyklopädien – ob thematisch oder alphabetisch – bestehen aus einer Hierarchie von Artikeln, die einen mit mehrfachen, die anderen mit weniger Bezügen zu anderen Artikeln. Die ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS macht, anders als alphabetische, aber auch anders als manche thematisch angelegten Werke, diese Bezüge explizit, indem sie ihre Hauptthemen untergliedert. Einzelartikel beziehen sich daher auf verschiedene Ebenen eines Themas, je nach Allgemeinheit bzw. Singularität ihres Gegenstandes. Diese Ebenen werden freilich nicht streng voneinander getrennt, sondern sie bilden vielmehr einen Rahmen, zu dem die Einzelartikel Stellung beziehen. In den seltensten Fällen sind „übergeordnete Artikel“ daher Resümees der in einem Abschnitt bzw. Unterabschnitt behandelten Themen. Die Autoren der Enzyklopädie haben vielmehr Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, die ihnen die relative Ordnung der Themen innerhalb der verschiedenen Abschnitte bot, um ihre eigene Perspektive auf das Thema und verwandte Themen deutlich zu machen. Daß die Perspektiven der Autoren dabei alles andere als einheitlich sind, drückt die reiche Vielfalt aus, die die moderne Mediävistik kennzeichnet. Dementsprechend nimmt auch die Bibliographie, die die Einzelartikel versieht, nicht für sich in Anspruch, vollständig oder endgültig zu sein, sondern sie bietet dem interessierten Leser vielmehr Einblick in den gegenwärtigen Diskussionsstand sowie Orientierung für weiterführende Recherchen.
Nicht nur die Vielfalt der Forschungsperspektiven wird durch die Untergliederung der Hauptthemen sichtbar, sondern auch die Art und Weise, wie diese miteinander verbunden werden. Denn die moderne Mediävistik ist nicht nur durch ihre Vielfalt, sondern auch durch ihre Interdisziplinarität gekennzeichnet. Damit sind wir bei den Themen, die die ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS in ihren Abschnitten behandelt.
Auch wenn einige Themen mit Teildisziplinen der Geschichte, wie z.B. der Literatur-, Wirtschafts- oder Technikgeschichte übereinzustimmen scheinen, muß zunächst festgestellt werden, daß alle Abschnitte den interdisziplinären Anspruch der ENZYKLOPÄDIE DES MITTELALTERS einlösen. Die erwähnten Gebiete haben sich genauso wie andere Teildisziplinen der Mediävistik dem allgemeinen Trend zur Interdisziplinarität geöffnet, wenn sie nicht sogar als Experimentierfelder für eine interdisziplinäre Mediävistik eine Vorreiterrolle in diesem Zusammenhang gespielt haben. Zu den letztgenannten gehören mit Sicherheit die Kunst- und die Musikgeschichte, die die Enzyklopädie genauso wie die räumlich arbeitenden Disziplinen miteinander kombiniert, wodurch sie eigene Akzente auf dem Weg zu einer interdisziplinären Forschung setzt.
Читать дальше