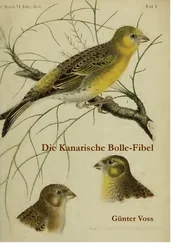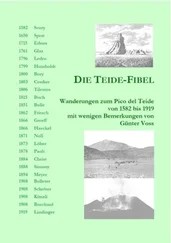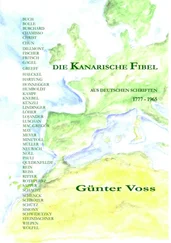Sie ahnte, was das zu bedeuten hatte, und errötete wie in Säure getränktes Lackmuspapier. Dann schenkte sie ihm ihr bezauberndstes Lächeln, wippte verführerisch mit den Augenbrauen und griff nach dem Buch, als wäre es aus Meißner Porzellan. Strahlend begann sie seine Zeilen zu lesen, doch dann, von einem Moment auf den anderen, reagierte ihr Gesicht wie erhitztes Kupferblech. Ihre Stirn zog sich in schwarzblättrige Falten, und die hinter den Kontaktlinsen funkelnden Augen erinnerten plötzlich an zwei salzsäurebeträufelte Petrischalen.
„Von ganzen Herzen? Soll das ein Scherz sein?“
„Aber nein, wieso? Ich liebe dich doch von ganzen Herzen!“
„Von ganzem Herzen. Dativ, nicht Akkusativ! Nein!“ Sie ließ das Buch zu- und ihren Mund wieder aufschnappen: „Wer sich nicht einmal beim Heiratsantrag die Mühe gibt, sich in korrektem Deutsch auszudrücken, der wird sich in der Ehe erst recht keine Mühe geben. Und mit so einem Menschen möchte ich nicht das Buch meines Lebens zusammen schreiben.“
Sprach‘s, warf ihm die gemeinsame Zukunft vor die Füße und verließ ihn.
Er erstarrte, fühlte sich zu Eis kondensiert. Wie hatte er das nur übersehen können? Dativ! Er hatte den schlimmsten Fehler seines Lebens begangen!
Doch je länger er darüber nachdachte, desto mehr wechselte sein psychischer Aggregatzustand, und schließlich verdampfte sein Entsetzen zu einem Gemisch aus Einsicht und Erleichterung (Ei 2Er 4). Nein, es war sein bester Fehler gewesen. Bestimmte Stoffe gingen einfach keine Synthese ein, und manchmal bedurfte es eines kleinen experimentellen Versehens, um das herauszufinden.
Manchmal, früh am Morgen, wenn der Himmel in rötlichen Träumen vor sich hindöst, wenn Stadt und Menschen sich in Zeitlupe bewegen und der Fluss noch nicht von Schiffen durchpflügt wird, geschieht es, dass sich die Wolken im Rhein spiegeln.
Martin lehnt sein Fahrrad an das Brückengeländer und zieht eine kleine Kamera aus seiner fleckigen Jacke. Am Himmel schwebt eine Cirruswolke. Ihr Abbild kräuselt sich in dem leicht gewellten Strom. Sie trägt ihren Namen zu Recht, denkt Martin. Die längliche Form und die ausgefransten Ränder erinnern tatsächlich an eine Feder. Außerdem wirkt sie federleicht, wie aus Spinnfäden gewoben.
Martin hat einmal gelesen, dass die Indios in Peru für rötliche Wolken am Morgen einen eigenen Begriff haben: antawara. Das klingt so, wie die Wolke aussieht, weit, weich und im Begriff, sich in der Unendlichkeit aufzulösen: antawara.
Er zwingt sich, den Blick abzuwenden, da es gleich hell wird und er sich mit seiner Arbeit beeilen muss. Am anderen Ende der Südbrücke wird er fündig. Zwei Dosen, drei Bierflaschen aus Glas, vier große Plastikflaschen. Der überdachte Brückenturm, in dem die Wendeltreppe nach unten zum Rheinufer führt, ist ein beliebter Platz für nächtliche Gelage. Auf den Wiesen der Rheinauen erspäht er weiteres Pfandgut. Heute ist ein ergiebiger Tag. Die Müllsäcke an den Lenkerseiten seines Fahrrads sind schon fast gefüllt. Gleich noch schnell zum Getränkemarkt nach Köln-Riehl, bevor die Flaschenmafia ihn hier erwischt. Er hat gesehen, wie sie Frank zusammengeschlagen haben. Nur weil er ein paar Bierdosen aus dem Mülleimer gezogen hat. Das hier ist ihr Revier, sagen sie. Mit hier meinen sie alle Stadtteile rechts und links vom Rhein, die zwischen Zoo- und Severinsbrücke liegen. Frank hat sich danach aus dem Staub gemacht. Ist wohl in die Randbezirke gezogen. Martin hat nie wieder von ihm gehört.
Das reicht, entscheidet er und stopft eine Wasserflasche in den linken Plastiksack. Der Gewinn reicht für Wein, Käse, Brot, Obst, Wasser, eine Tafel Schokolade. Damit verbringt er einen herrlichen Tag in seinem Schwalbennest, um die Wolken zu beobachten.
Am Himmel zieht ein Flugzeug vorbei. Martin schaut hinauf und lächelt. Die Erinnerung ist sofort wieder da. Vor sieben Monaten hat er sich einen Traum erfüllt. Ist von Köln nach München geflogen. Fast ein Jahr hatte er dafür gespart, aber der Flug war jeden Cent wert gewesen. Wie in einem Film erlebt er die Höhepunkte ein weiteres Mal: die prickelnde Vorfreude, als er im Flugzeug sitzt und auf die Freigabe zum Start wartet; das mulmige Gefühl, beim Beschleunigen in den Sitz gepresst zu werden; der atemberaubende Augenblick, in dem die Räder sich vom Boden lösen; die wahnsinnige Freude, den Wolken immer näher zu kommen; der Schwindel beim Eintauchen in die weißen Schwaden; das Herzrasen, als die Maschine das weiße Meer durchpflügt, die Wolkengischt gegen die Fenster schlägt, das trübe Weiß immer lichter wird, bis es so gleißend leuchtet, dass er die Augen schließen muss. Und dann, dann der magische Moment, in dem das Flugzeug in den blauen Himmel auftaucht. Die Wolken unter ihm eine Landschaft pulsierender Krater, ein Türmen und Blähen, Wölben und Strecken, Schrumpfen und Zerfließen, als besäßen sie ein Eigenleben. Später reißt die Wolkendecke auf, formt langgezogene Inseln, auf deren Grund sich Felder, Straßen, ein Fluss abzeichnen, so unerreichbar, wie es zuvor der Himmel war. Wolken wie Tiere, wie Baumkronen, wie Blumenkohl, wie Köpfe, wie Buchstaben, Stiefel, Münder, Augen, wie Herzen. Was Martin immer schon geahnt hat, wird nun zur Gewissheit: Wolken sind Bilder, gemalt von göttlichen Wesen, die ihre Finger in Farbe tunken, um sie über eine blaue Leinwand zu streichen.
Als er aus seinen Träumen in die Gegenwart zurückkehrt, ist das Flugzeug verschwunden. Nur noch die faserigen Kondensstreifen erinnern an seine Existenz. Langsam lösen sie sich auf. Wie unser Leben, denkt Martin und schiebt sein Fahrrad am Rheinufer entlang, bis er das Basketballfeld erreicht. Da sieht er sie auf der anderen Seite des Flusses. Ein Cumulo-Nimbus, und was für ein Prachtexemplar: weiß leuchtend die Schultern, der Rücken elfenbeinfarben und der Bauch in einem strahlenden Blaugrau. Auf dem Kopf erheben sich drei Wirbel, die an eine Krone erinnern. Das Spektakuläre aber ist, dass sich die Wolkenkrone wie ein Heiligenschein über die Türme des Kölner Doms gelegt hat. Der Anblick ist so atemberaubend, dass Martin alles um sich herum vergisst. Erst als ein Windstoß die Plastiktüten an seinem Fahrrad klappern lässt, kommt er wieder zu sich. Er zückt seinen Fotoapparat und macht Aufnahmen.
„He, du Arschloch!“ Die Stimme hinter seinem Rücken lässt ihn zusammenzucken. Vielleicht ist ja gar nicht er gemeint.
„Eh, Pisser!“ Die Stimme hat sich genähert, ist direkt hinter ihm.
„Der Penner ist taub“, mischt sich eine zweite Stimme ein, quäkend, kläffend.
Martin dreht sich langsam um. Die Flaschenmafia! Den Muskelprotz mit der Mütze und dem Bart hat er schon häufiger hier am Rheinufer gesehen. Er scheint der Anführer zu sein. Den Besitzer der quäkenden Stimme erkennt er auch wieder. Er war derjenige, der Frank ins Gesicht getreten hat, als er bereits am Boden lag. Martin sackt das Herz in die Kniekehlen.
„Meinen Sie mich?“, sagt er, um irgendetwas zu sagen.
„Siehst du sonst noch ein Arschloch hier?“
Zwei, denkt Martin, aber schüttelt den Kopf.
„Na dann. Was machst en hier?“
„Ich gehe spazieren, fotografiere Wolken. Ist ein Hobby von mir“, antwortet Martin so beiläufig wie möglich.
„So so, der Herr macht einen Spaziergang und fotografiert Wolken. Das ist ja en Ding. Dann wollen wir nicht weiter stören“, sagt der Bärtige und wendet sich ab. Martin atmet auf. In diesem Moment schnellt der Mann herum und schmettert ihm die offene Hand ins Gesicht. Martin fliegt rückwärts über sein Fahrrad und bleibt benommen am Boden liegen. Sofort sind die beiden über ihm. Der Große stemmt seinen Schuh auf Martins Hals, der Kleine tänzelt wie ein Boxer um ihn herum: ein Hund, der darauf wartet, dass sein Herrchen die Beute freigibt.
Читать дальше