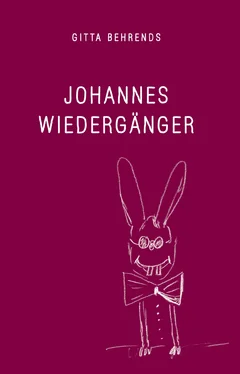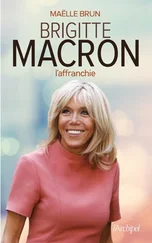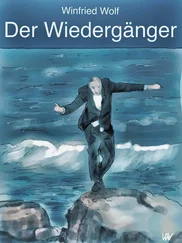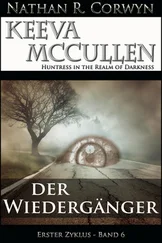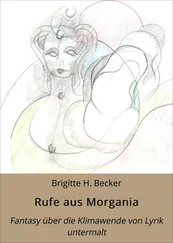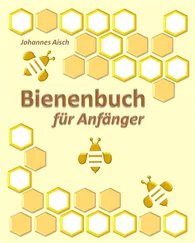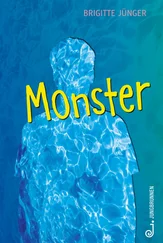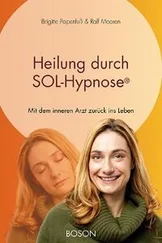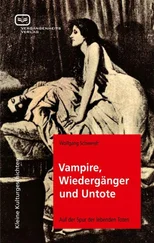Brigitte Pyka-Behrends - Johannes Wiedergänger
Здесь есть возможность читать онлайн «Brigitte Pyka-Behrends - Johannes Wiedergänger» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Johannes Wiedergänger
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Johannes Wiedergänger: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Johannes Wiedergänger»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Klara ist beruflich erfolgreich, scharfzüngig und in ihren Freundschaften etwas sperrig, aber gern Gastgeberin und dort, wo sie Zuneigung verspürt, auch großzügig und liebevoll.
Johannes Wiedergänger — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Johannes Wiedergänger», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die fängt ja früh an, wird mein Vater gedacht oder gesagt haben. Kochend vor Wut. Sofortiges Einschreiten war nötig. Wie er den Kontakt unterbunden hat, weiß ich nicht, jedenfalls nicht wie ein paar Jahre später. Da war ich neun oder zehn Jahre alt und somit noch gefährdeter als im Alter von sechs, sieben Jahren.
Wir waren zu der Zeit in einen Neubau gezogen, raus aus der barackenähnlichen Unterkunft, in der wir zusammen mit den Großeltern gelebt hatten. Aus unserer neuen Wohnung, die im vierten Stock lag, hatten wir einen weiten Überblick über die Straße, in der wir nun zu Hause waren. Aus dem Küchenfenster heraus wird mein Vater mich entdeckt haben (ja, ich stand unter fast ständiger elterlicher Beobachtung), als ich in einer kleinen Gruppe aus dem Freibad kam. In der Gruppe befand sich auch ein Junge, der nach Ansicht meines Vaters nur mich meinen konnte als das Objekt seiner Begierde. Was so falsch nicht war, denn der Junge hatte mir im Schwimmbad ein paar bunte Karten angeboten: Porträts von den Größen der Leinwand und von Sängern und Sängerinnen. Fotos, auf die wir alle erpicht waren, die ich aber selbstverständlich nicht annahm. Mein Vater muss die Treppen vom vierten Stock bis hinunter auf die Straße geflogen sein – immer fünf, sechs Stufen auf einmal nehmend. Die Kraft, mir eine schallende Ohrfeige zu versetzen, hatte er allerdings noch. Vor einem erschrockenen Publikum. Ich ging nie wieder ins Freibad. Die Scham über die öffentliche Demütigung war zu groß.
Die Familie von Johannes war stadtbekannt und wahrscheinlich darüber hinaus. Sein Vater war Künstler: Maler und Bildhauer, und einige seiner Skulpturen wurden von der Stadt angekauft und im Stadtgarten und längs des kleinen Flusses aufgestellt, der unsere Stadt in eine Ober- und Unterstadt teilte. Wir wohnten in der Unterstadt wie auch mein kleiner Kavalier. Doch nicht in unmittelbarer Nachbarschaft. Er muss einen Umweg gemacht haben, um mich auf dem Weg zur Schule abzufangen, denn es gab einen sehr viel kürzeren Weg von seinem Elternhaus zur Schule. Ich muss also wieder einmal beobachtet worden sein, doch anders als die elterlichen Observationen rührte mich die vom kleinen Johannes, als er mir auf meinem blauen Sofa in Kreuzberg, etwa zwanzig Jahre später, wieder einfiel.
Ich habe überlegt, ob der Kontakt zu einer frühen kindlichen Begleitung in die Schule nicht so abrupt durch meinen Vater unterbunden worden wäre, wenn die Familien von Johannes und mir unmittelbare Nachbarn gewesen wären. Nachbarn, die sich miteinander unterhielten und im Sommer im Innenhof unseres Hauses, in dem ich geboren wurde, zusammen saßen und auf ihre flapsige Art die eigentlichen Nöte wegdrängten, da die Sonne schien und der nächste Tag ein Sonntag war. Mal wieder ausschlafen dürfen. Wäre also ein Nachbarsjunge aus dem Haus, in dem wir zusammen mit unseren Großeltern lebten, weniger suspekt gewesen, weil kontrollierbarer, und der gemeinsame Gang in die Schule somit geduldet?
Aber diese Frage war müßig. Denn damals herrschte eine absolute Geschlechtertrennung in unserer katholisch geprägten Kleinstadt am Niederrhein – sieht man einmal ab von der gemischten ersten, zweiten und dritten Schulklasse, die es ab dem vierten Schuljahr auch nicht mehr gab. Es gab einfach keine gemeinsamen Wege von Jungen und Mädchen und kein gemeinsames Spiel. Und je ärmer die Familien waren, desto strenger wurde auf Trennung geachtet. Es musste also ein Fremder kommen, Sohn eines Künstlers, der sich die Freiheit zu unerlaubter Nähe nahm. Vielleicht kannte er die Regeln der sogenannten Unterschicht nicht oder sie waren ihm schnurzpiepegal.
Wann ich mich in meiner Erwachsenenwelt zum ersten Mal an Johannes erinnerte, weiß ich also noch gut. Ich hatte ein zwei Tage währendes Trinkgelage hinter mir und lag verkatert auf meinem kleinen blauen Sofa mit Blick auf sehr viel Grün und in der Ferne sah ich den Alex. Ich lebte in Kreuzberg. Um mich herum wirkliches Leben: Wohngemeinschaften zur Linken, die sich wieder einmal zu einer Fete zusammenfanden bei lauter Musik, aber nicht laut genug, um das enthusiastische Stimmengewirr in ihrem Haus zu übertönen; Kinder auf einem sehr großzügig gestalteten Freiauslauf vor unseren Häusern, die bis spät in die Nacht dort herumtoben durften; Nachbarn in meinem Haus, die sich von Fenster zu Fenster in einer Sprache unterhielten, die ich weder verstand noch verstehen wollte. Ich wollte gar keine Stimmen hören.
Ich war frustriert. Wieder einmal. Es gab durchaus eine Einladung aus dem Wohngemeinschaftshaus zur Linken: Willste nicht auch kommen? Wir machen Fete. Kurze Zeit vorher hatte mich dieser Wohngemeinschaftsgenosse angerufen, um mich zu fragen, ob ich in der Wohnung, in der ich seit einigen Wochen lebte und in der ich mein Nest gefunden hatte, wirklich weiterhin unbedingt leben wollte. Die Wohnung sei doch eigentlich viel zu groß für nur eine Person und die Mutter seiner kleinen Tochter bräuchte unbedingt ein neues Domizil in seiner Nähe, damit sie sich mit der Betreuung der Tochter abwechseln könnten.
Eines der ungeheuerlichsten Telefonanrufe meines Lebens. Wenn auch nicht das einzige dieser Art. Es folgten weitere während der Dauer meines Kreuzberger Lebens: Ich habe drei Kinder, drei! und mich gerade von meinem Partner getrennt. Kannste dir nicht `ne kleinere Bleibe suchen? (Alternativ: Können wir nicht unsere Wohnungen tauschen?)
Dabei waren es keine Sozialhilfeempfänger, die auf einen Einzug in meine Wohnung drängten. Sie hätten sich durchaus eine größere Wohnung leisten können und sie auch ziemlich schnell bekommen. Es gab noch keinen Wohnungsnotstand. Aber das Haus, in dem ich lebte, lag schön eingebettet in viel Natur und bot einen für Kreuzberg überraschend weiten, freien Blick. Was also wollte ich, die Single-Frau, mit so viel Wohnqualität? Jahre später, als die Wohnungen zum Kauf angeboten wurden, meldeten sich alle noch einmal (und ein paar andere dazu). Ob ich mir den Kauf meiner Wohnung überhaupt leisten könne? Es würde ja heißen, ich ginge wieder zur Schule, um das Abitur zu machen. Respekt übrigens für diese Veränderung, denn die Jüngste für einen Schulbesuch sei ich schließlich nicht mehr.
Wiederum einige Jahre später fiel die Mauer und der gesellschaftliche Umgangston auf der Duz-Ebene mit hastemal, kannstemal, sei mal ein bisschen solidarisch!, wurde zurückgedrängt durch Gruppen, die sich einfach nahmen, wovon sie sich einen Profit versprachen. Und sie fanden ein Klientel, das finanzkräftig genug war, aufwändig sanierte und restaurierte Wohnungen in unserem Kiez zu kaufen oder zu mieten. Und nebenbei ein bisschen Kreuzberger Lokalkolorit am Abend zu genießen, als Kompensation ihres kräftezehrenden Lebens in der Wirtschaftswelt.
Haste eigentlich einen Vogel?, hätte ich den Anrufer aus der Wohngemeinschaft fragen sollen und den Telefonhörer sofort auf seine Station knallen müssen, als der Kreuzberger Kiez, in dem ich lebte, vor dem Mauerfall noch eine Nische war für diejenigen, die sich künstlerisch ausleben wollten. Wie auch ein Teil der Wohngemeinschaftsleute im Nebenhaus. Oder einfach nur nächtelang durchmachen wollten, was für diesen Teil im Nachbarhaus nicht unbedingt galt. Oder beides wollten wie viele andere in unserem Kiez. Ich habe dem künstlerischen Genossen im Nebenhaus zwar einen negativen Bescheid gegeben, aber mit so viel überflüssigem Drumherumgerede, dass ich wie schuldbewusst geklungen haben muss. Und dann ruft mich der Typ ein paar Tage später an, um mich zu einer Fete einzuladen: Es gibt Bier und Wein, Salate und Würstchen, teilte er mit.
Wie schön. Als könnte ich mir selbst Bier und Wein, Salate und Würstchen nicht leisten. Es lag doch auf der Hand, dass er sich mit mir in eine ruhige Ecke der Wohngemeinschaft verdrücken und weichklopfen wollte, damit die Frau, die er geschwängert hatte mit dem Ergebnis dieser Schwängerung immerhin in seiner Nähe leben konnte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Johannes Wiedergänger»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Johannes Wiedergänger» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Johannes Wiedergänger» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.