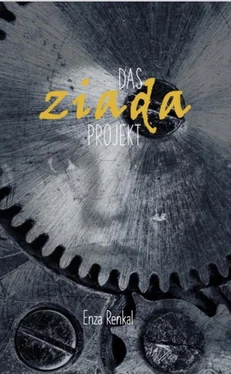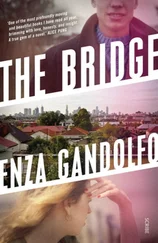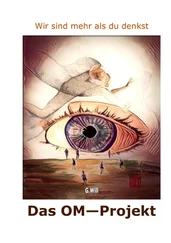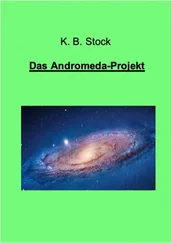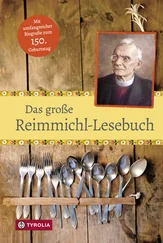Die erste Assistenz, ein nur halb voller Rucksack mit einer Wolldecke, einem Erste-Hilfe-Kasten und einer Flasche Wasser, sammelte ich aus einem stillgelegten Gully. Die nächste war nicht mehr dort, wo ich sie deponiert hatte, aber das dritte und vierte Paket, jeweils zwei Dosen Essen und ein kleiner Campingkocher, packte ich zur Hälfte in den Rucksack und zur Hälfte in die Sporttasche. Meine letzte Haltestelle ließ mich noch vorsichtiger werden. Wenn der Autoschlüssel nicht mehr dort war, wo ich ihn versteckt hatte, war mein ganzer Plan hinfällig.
Ich schielte um die Hausecke, doch ich konnte nichts Verdächtiges beobachten. Während ich zielstrebig auf Hausnummer 59 zuhielt, schweiften meine Gedanken kurz ab. Hatten sie Ric bereits gefunden? War er im Krankenhaus? Hatte ich ihn ernsthaft verletzt? War der Nabel informiert? Suchte er nach mir? Sahen sie, dass sie mich nicht mehr orten konnten? Und was zum Teufel war mit mir passiert, als ich Ric angegriffen hatte? War das einfach nur eine übermäßige Ausschüttung von Adrenalin gewesen? Ich war mir darüber im Klaren, dass ich mich verteidigen konnte. Das war der Zweck der Ausbildung gewesen. Aber doch nicht so! Mein Körper hatte sich verselbstständigt. Ich war mein eigener Zuschauer gewesen. Als hätte etwas anderes die Kontrolle über mich übernommen.
Ich schob die Fragen beiseite und lehnte mich gegen die Hauswand links neben Nummer 59. Meine linke Hand ertastete den losen Ziegelstein, während ich weiter die Umgebung beobachtete. Erleichterung breitete sich in mir aus, als ich Metall spürte und den Autoschlüssel in der Hand hielt. Ich schob den Ziegel wieder zurück auf seinen rechtmäßigen Platz und verstaute den Schlüssel sicher in meiner Jackentasche. Die Kapuze über den Kopf ziehend, setzte ich mich wieder in Bewegung. Ich packte die Riemen meines Rucksacks und verfiel in einen leichten Laufschritt, der mich zügig voranbrachte, ohne dass ich zu sehr auffallen würde.
Ich hatte das Auto hinter dem zentralen Bahnhof geparkt. Dort fiel es nicht auf, wenn der Volvo länger nicht bewegt wurde. Der Bahnhof war einige Kilometer von mir entfernt. Zu Fuß würde ich erst im Dunklen ankommen. Aber ich wagte es nicht, mich öffentlich fortzubewegen; viel zu viele Überwachungskameras.
Ein Gedanke schob sich in den Vordergrund, während ich zielstrebig auf dem Weg zu meinem Auto war. Würden sie Marie aufsuchen? Und befragen? Sie würde ihnen nichts verraten können und offen mit ihr sprechen, konnten sie auch nicht. Sie konnten ihr nicht vom Nabel erzählen. Ich hatte den Wunsch ihr zu sagen, dass es mir gut ging, aber die Angst sie in Gefahr zu bringen, war sehr viel größer. Marie aufzusuchen, machte sie nur zur Zielscheibe. Ich kramte meine Kopfhörer aus der Sporttasche und stöpselte sie in mein privates Handy. Keine Ortung, keine Überwachung. Mit Musik in den Ohren war mein Weg schon deutlich angenehmer.
Die Verlockung, die Alufolie von der Uhr zu nehmen und zu schauen, ob ich eine Nachricht bekommen hatte, überkam mich nach einer knappen Stunde. Von Ric, vom Nabel, von Leander, von Irgendjemand. Aber das würde ich erst wagen, wenn ich mir sicher sein könnte, dass ich das GPS manuell ausschalten konnte. Aber dafür müsste ich an das Gehäuse und das setzte voraus, dass ich die Uhr abnahm. Ich legte sie nicht beim Duschen, Schwimmen oder Schlafen ab. Die vollkommene Überwachung. Mit den richtigen Zahlen auf dem Konto stellte man keine Fragen. Ich begann mich vor mir selbst zu ekeln und das Gefühl war schlimmer als jegliche körperlichen Schmerzen.
Ich drehte die Musik lauter und legte an Tempo zu. Es begann zu dämmern und den letzten Kilometer wollte ich joggend zurücklegen. Doch die letzten Meter rannte ich mir die Seele aus dem Körper. Das Bedürfnis etwas hinter mir zu lassen, war erdrückend. Doch das etwas war viel zu groß und schien mich an unsichtbaren Fäden zurückzuziehen. Nach Atem ringend blieb ich vor dem Volvo stehen, öffnete die Fahrertür und legte mein Gepäck neben mir auf dem Beifahrersitz ab. Ich schloss die Autotür und versuchte mich zu beruhigen. Schon zum dritten Mal an diesem Tag musste ich das Bild des Sees hervorrufen, um mich wieder wie einen real existierenden Menschen zu fühlen.
Nachdem ich den Schlüssel in das Zündschloss gesteckt hatte, schaltete ich mein Handy aus und umgriff mit beiden Händen das Lenkrad. Ich starrte mein eigenes Spiegelbild in der Windschutzscheibe an. Die Person, die heute zum ersten Mal nach fast einem Jahrzehnt seinen Kindernamen gehört hatte. Die zum ersten Mal in ihrem Leben einer 1./ begegnet war. Die in einem Verhör über Erinnerungen saß. Die ihren Chef krankenhausreif verprügelt und ihren einzigen Freund verloren hatte. Ich wandte den Blick nach unten auf das Lenkrad, um mich nicht mehr ansehen zu müssen. Die Stirn auf dem weichen Leder des Lenkrads ablegend, begann ich zu weinen. Und die Tränen taten ihren Dienst. Sie ließen die Realität vor meinem Auge verschwimmen und spülten mein Inneres sauber. Zumindest für den Moment. Es war eine Illusion zu glauben, dass es mir damit langfristig gut ging. Mit einer einzigen Frage im Kopf und in einer äußerst unbequemen Stellung schlief ich ein. Wer war ich?
Das Bedürfnis, mich zu erleichtern, weckte mich auf und ich stieg unbeholfen aus dem Volvo. Es war noch dunkel. Viel hatte ich nicht geschlafen, aber ich fühlte mich heute schon deutlich besser. Ich streckte meine Muskeln, verrichtete die Notdurft zwischen den Autos und musterte meine Umgebung, so gut es in der Dunkelheit ging. Zurück im Auto überprüfte ich die Uhrzeit über die Cockpit-Uhr des Volvos. 5.39. Ich kontrollierte die Alufolie an meinem Handgelenk, startete den Motor und parkte aus. Den anderen Bedürfnissen nach Essen und Trinken würde ich erst nachgehen, wenn ich einen ordentlichen Abstand zur Stadt bekommen hätte.
Ich ließ das Radio aus, genoss die Stille und die noch leeren Straßen. Ein leichtes Unbehagen kam auf, dass ich nicht bereits gestern Linberg noch verlassen hatte, aber den Schlaf hatte ich dringend gebraucht. Ich kontrollierte meinen Rückspiegel öfters als nötig, aber auch nach eineinhalb Stunden Fahrt war ich immer noch ein einsames Auto auf der Landstraße. Wo fuhr ich eigentlich hin? Weit genug weg von der Stadt war ich, oder? Als auf der rechten Seite ein Waldweg abzweigte, hielt ich kurz an und kramte aus dem Handschuhfach eine Karte.
Der nächste größere Ort war ungefähr zwanzig Minuten von mir entfernt. Im Umkreis von mehreren Kilometern war keine einzige Ortschaft. Hier war ein guter Ort, um vorerst unter-zutauchen. Ich bog in den Waldweg ab und fuhr nach ein paar Kurven, so dass ich mir sicher sein konnte, von der Straße aus nicht mehr gesehen zu werden, auf ein Stück Waldboden, das relativ stabil aussah. Sich hier und jetzt festzufahren, wäre ziemlich doof. Ich nahm mein Gepäck vom Sitz neben mir und öffnete den Kofferraum. Vor mir lag nun eine ganze Menge an Utensilien, denn das Auto war zu jedem Zeitpunkt bereit gewesen, mich nicht nur aus der Stadt zu bringen, sondern auch mit Allerlei zu versorgen.
Ich entleerte zunächst den Rucksack und sortierte den Inhalt auf die entsprechenden Stapel, die ich angelegt hatte. Auf dem Stapel für medizinische Versorgung lagen nun drei erste Hilfe Kasten, zwei dünne Decken, eine Signalrakete und eine eingeschweißte Liste mit den wichtigsten Telefonnummern. Auf den Stapel für Klamotten konnte ich nur die Wolldecke legen, aber er war bereits ausreichend umfangreich. Zu dem Stapel mit Verpflegung kam nun das Essen und Trinken dazu. Ich wollte mir von beidem etwas nehmen, aber ich genehmigte mir nur einen Schluck Wasser. Erst musste alles seine Ordnung haben. Ich sortierte den Inhalt der Sporttasche auf die Stapel, griff dann nach einem Müsliriegel und setzte mich auf die Kante des Kofferraums.
Читать дальше