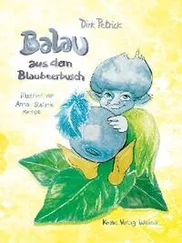Er täuschte Übelkeit vor, wies Tee und Wärmflasche ab, legte sich ins Bett und zog die Decke über den Kopf. »Fa’ahe’e ti’a ai vau«, murmelte er, bevor er einschlief, »ich muss verschwinden«.
Tante Thérèse war eine Dame mittleren Alters, mittlerer Größe und mittelschlanker Figur. Sie trug stets ein mittelgraues Kostüm, wie es zehn Jahre zurück in Mode gewesen war, freilich nicht so stark tailliert wie die Tailleur Bar-Stücke von Dior, gewiss nicht, keinesfalls so hüftbetont wie der New Look mit dem reizenden kleinen Aufschrei der Jackenschöße, dahin reichten weder Geschmack noch Mut. Dazu ein Rock, auch er nicht zu eng geschnitten und locker bis zur Wade, auf jeden Fall die Knie bedeckend, alles in allem, bei Licht betrachtet, das falsche Zitat einer unverstandenen Mode, deren Zeit sich dem Ende zuneigte. Die verwendeten Stoffe waren exquisit, keine Frage, und die stets weiße Bluse an besonderen Tagen gar aus Seide (sie besaß eine mit einer großen Schleife am Kragen), was ihr ein verstörend extravagantes Flair verlieh, das in starkem Gegensatz zu ihrem strengen, pragmatischen Auftreten stand. Tante Thérèse trug ihr schwarzes Haar kinnlang, ziemlich hoch auf der Stirn waren die Fransen schnurgerade abgeschnitten, eine Frisur, die einen belesenen Zeitgenossen unweigerlich an Flauberts Vergleich erinnern musste: wie ein Dorfkantor. Clément hatte selbstverständlich Madame Bovary noch nicht auf seinem Lesezettel, und da er Tante Thérèse erst zweimal (bei der Beerdigung eines Großonkels und bei seiner eigenen Erstkommunion) gesehen hatte, war sie ihm nahezu fremd und er betrachtete sie unvoreingenommen, jedoch mit Zurückhaltung.
Die Tante wohnte in einem viergeschossigen Gebäude auf der Nordseite der Place de la République, errichtet aus dem hellen Stein der Region, wie die meisten Gebäude der Stadt. Es schaute mit nobler Attitüde hinaus auf den weiten Platz, ganz Ausdruck des arrivierten Bürgertums der 1880er Jahre, das die Enge der ummauerten Altstadt hinter sich gelassen hatte. Thérèse Martinez bewohnte die zweite Etage mit ihren Porte-fenêtres und den kunstvollen schmiedeeisernen Gittern davor. Aus ihrem Wohnzimmer hatte man einen wundervollen Blick durch die Ahornbäume, die den Platz umstanden, auf den Pylon des Denkmals für Sadi Carnot, Abgeordneter des Departements und Präsident der Republik, wie Clément bald lernte. Hatte man die Wohnung betreten und wandte sich von den repräsentativen Räumen ab, die auf der Frontseite lagen, sah man einen schmalen Flur ins Innere des Hauses führen. Dort lagen Küche, Bade- und die Schlafzimmer.
Ganz am Ende öffnete sich die Tür zu Cléments neuem Domizil, das nur drei Schritte tief, aber bald sechs Meter lang war und sich an die Rückwand des Hauses schmiegte. Durch ein kleines Fenster gleich gegenüber der Tür fiel ein wenig Licht ins ewige Halbdunkel des Raums, das von einer dreiarmigen Deckenlampe aus cremeweiß mattierten, mit Streublümchen verzierten Glasschalen mehr schlecht als recht erhellt wurde. Cléments Mutter hatte seine Wäsche, Strümpfe, Hemden, Hosen und was er sonst nötig hatte in dem Schrank verstaut, für seine Bücher war wenig Platz auf einer Kommode neben seinem Bett, der Globus fand seinen Ort auf dem Schreibtisch, den er wegen der schlechten Lichtverhältnisse zum Lernen und für Schulaufgaben sowieso nicht nutzen konnte; er zog es vor, im Wohnzimmer zu arbeiten, wo er sich gern durch das Treiben auf dem Platz ablenken ließ. Täglich war hier Markt, eine Selbstverständlichkeit für die Stadtbewohner, ein Erlebnis mit Wiederholungsgarantie für den Heranwachsenden. Da seine Tante, die immer mit irgendetwas beschäftigt war, ihn häufig zum Einkaufen schickte, lernte er hier den Umgang mit fremden Menschen, Fragen und Antworten, seinem Urteil zu vertrauen, den Versprechen der Erwachsenen gegenüber skeptisch zu sein. Und er lernte Gemüse und Obst, Fisch und Fleisch, Kräuter und Gewürze, Küchen- und Haushaltsutensilien kennen. Kurzum: Er hatte die Welt betreten.
Nicht mitgebracht hatte er Panpan, den Hasen, seine Spieldose mit dem kindischen Dodo, l’enfant, do , seine Bilderbücher, seine Schatzkiste mit Kreisel, Plastiktierchen, Kieselsteinen und was Kinder sonst noch sammeln. Seine Mutter stellte das Bild von der Marienerscheinung der Hl. Bernadette auf die Kommode, doch er legte es sofort nach ihrer Abreise zurück in den Koffer, den er unter das Bett schob. Mitgebracht hatte er jedoch seine Gitarre, auch wenn Mutter tagelang dagegen opponiert hatte. »Du wirst genug zu tun haben im Collège, da solltest du dich nicht mit so etwas belasten.« Schon dass sie ›mit so etwas‹ sagte, machte ihn wütend, und ›belasten‹ machte ihn fassungslos. »Dein Vater möchte gewiss nicht hören, dass du rumklimperst, statt zu lernen.« In diesem Augenblick war er sich sicher, dass er die Gitarre mitnehmen würde. »Such dir doch lieber neue Freunde, mit denen du was unternehmen kannst.« So fand die Gitarre ihren Platz in der Ecke seines Zimmers, und die Tatsache, dass dieser Platz so weit entfernt vom Zentrum des Lebens in Thérèses Wohnung war, ermutigte ihn, sie nicht zu vernachlässigen.
Mit den Freunden war das so eine Sache. Clément stellte fest, dass es in der neuen, größeren Klassengemeinschaft dieselben Typen gab, wie sie ihm in St. Didier begegnet waren, nur dass sie andere Namen trugen. Es gab den Anführer, den Clown, den Streber, den Frechen und es gab Clément, der sich am liebsten aus allem raushielt, von allen fernhielt. Der Weg zur Schule war nicht weit, aber er musste drei Stationen mit dem Bus fahren, wenn er es so bequem wie möglich haben wollte. Oder schon an der zweiten Haltestelle aussteigen, wenn er den Brüdern Garnier entgehen wollte, die jeden, der nicht größer, stärker und schneller war, drangsalierten, wie immer sie wollten. Wenn er morgens getrödelt hatte oder es regnete, dann nahm er das Risiko in Kauf, hielt Wetten gegen sich selbst, ob sie es heute auf irgendeinen anderen Mitschüler oder auf ihn selbst abgesehen hatten und – wenn Letzteres eintreten sollte – ob es bei schmerzenden Knuffen bliebe oder ob sie ihm den Ranzen abnähmen, um sein Federmäppchen zu entführen, oder ihn gar am Aussteigen hinderten, so dass er dann erst den Bus an der vierten Station verlassen konnte, die sich hinter dem Bahnhof befand, er mehr als einen halben Kilometer zurücklaufen musste, rennen gar, wenn es knapp wurde und er eine förmliche Ermahnung vermeiden wollte.
Einmal, ganz zu Anfang, verlief er sich, rannte in die falsche Richtung, gelangte über die Rue Hoche zum Ufer der Ouche, viel zu weit war er gelaufen und trotz der Zweifel, die er nicht wahrnehmen wollte, nicht umgekehrt, hatte niemanden zu fragen gewagt, doch jetzt war es zu spät, viel zu spät. Er drückte sich im Botanischen Garten herum, ein französischer Park, typisch durch seine Ordnung und seine Strenge, seine Blumenrabatten und geraden Wege, ein Park, der nur im Arboretum der Ungebühr der Natur nachgab, wo es krumme Bäume und gewundene Pfade gab. Dort trieb er sich herum, bis er getrost nach Hause gehen durfte, und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil er befürchtete, an den Ohren aus dem Bett und zu seiner Bestrafung geschleift zu werden. Aber zu seinem grenzenlosen Erstaunen wollte niemand jemals von ihm wissen, wo er an diesem Tag abgeblieben war, noch nicht einmal sein Banknachbar, wo doch in St. Didier-les-Saules vom Gemeindediener bis zum Pfarrer und vor allem: bis zu seinen Eltern jeder innerhalb kürzester Zeit besorgt oder erzürnt gewesen wäre, je nach Temperament, Charakter und eigener Intention.
Er musste vier Jahre Collège überstehen, vier Jahre Tante Thérèse, vier Jahre Großstadt, und dann, dann würde man sehen.
Wenn er nachmittags im Salon saß, um seine Hausaufgaben zu erledigen oder zu lernen, dann ließ er die Tür zur Diele einen Spalt offen, um mitzubekommen, was draußen vor sich ging. Er kannte ja das Messingschild neben der Haustür, auf dem sich Thérèse Martinez als Naturopathe bezeichnete ( Sitzungen nach Vereinbarung ), in einem der vorderen Räume hielt sie ihre Sprechstunden als Heilpraktikerin. Mit all dem wusste Clément allerdings überhaupt nichts anzufangen. Es musste etwas mit Krankheiten zu tun haben, soviel war klar, aber da er zu allem, was den menschlichen Körper betraf, Abstand hielt, wagte er nicht zu fragen. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass er auf solche Fragen keine oder keine zufriedenstellenden Antworten erhielt, und er leitete daraus ab, dass körperliche Vorgänge sich nicht zum Gegenstand allgemeiner familiärer Betrachtung eigneten.
Читать дальше