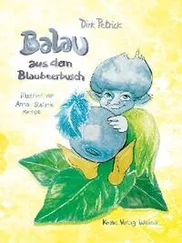Es kamen nur wenige Patienten, die seine Tante – jetzt in einen weißen Kittel gekleidet – in ihr Sprechzimmer führte, fast ausschließlich Frauen, durchweg ältere, woraus Clément wiederum unüberprüfbare Schlüsse betreffend die Natur der Erkrankungen und deren Behandlung zog, die diese Menschen hier erfuhren. Manchmal wagte er sich hinaus in die Diele, wo er sich nahe genug an der Wohnzimmertür aufhielt, um einen schnellen Rückzug einleiten zu können, und versuchte zu lauschen. Dann hört er gedämpfte Gespräche, unterbrochen vom harten Schritt seiner Tante, die wohl hier und da etwas aus einem Schrank oder Regal holte, manchmal vernahm er auch inmitten dieser Gespräch unterdrücktes Schluchzen, und wenn er dann wieder am Tisch saß, über seine Schularbeiten gebeugt, dann hörte er, wie die Patienten zum Abschied sich vielmals und tief empfunden bedankten, und er wusste, dass Tante Thérèse etwas Wichtiges und Gutes tat.
Eines Samstagmorgens, der Tag, an dem er sich im Nachthemd an den Frühstückstisch begeben durfte, an dem ihm (statt der Schale mit dem dünnen Milchkaffee und dem Weißbrot mit Reneclauden-Marmelade oder schwarzem Johannisbeergelee) ein richtiges Tässchen Kaffee erlaubt war, eine Scheibe Kochschinken zu dem Landbrot mit der großporigen Krume, ein Croissant mit Kastanienblütenhonig, ein Duft und Geschmack, der ihn zeitlebens begleiten sollte, an einem solchen Samstagmorgen, nicht von dieser Welt, saß Jeanne mit am Tisch. Er hatte die Frau mit dem langen blonden Haar noch nie zuvor gesehen, und nun saß sie da, beherrschte geradezu die Frühstückstafel, fast einen Kopf größer als Tante Thérèse, mächtig saß sie da, mit einer Oberweite, die Clément nicht nur erahnen konnte, denn sie trug ein Nachthemd, das ihr auf den Leib geschneidert worden sein musste, und wiegte sich beim Sprechen hin und her, nach vorn, nach hinten, wobei sie alles, was sie sagte, mit ausholenden Bewegungen ihrer kräftigen Hände unterstrich, bevor sie wieder nach dem Brot auf ihrem Teller griff und herzhaft hineinbiss. Thérèse warf nur dann und wann etwas ein, vermied den Blickkontakt sowohl mit ihr als auch mit ihrem Neffen und widmete sich Teller und Tasse.
Clément gelang es nicht, irgendetwas von diesem Tischgespräch in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem zu bringen, was er wusste oder sich zusammenreimte, gab sich jedoch bei aller Verunsicherung den Anschein des Abgeklärten, dem nichts, was aus der Erwachsenenwelt ihm auf die Füße fiel, verunsicherte. Dann wurde er ins Bad geschickt, wusch sich, zog sich an und hörte aus der Diele Tante Thérèse rufen: »Wir sind bald wieder da«, bevor er allein war in der großen Wohnung. Samstags gingen Thérèse und diese Jeanne gemeinsam auf den Markt, blieben lange fort, meist fiel das Mittagessen aus, dafür brachten sie Éclairs und Paris-Brest, Macarons, gefüllte Brioche oder andere Köstlichkeiten mit, die sie zum Kaffee (die Damen) und zur Schokolade (der junge Herr) genossen.
Während dieser – oft stundenlangen – Abwesenheiten, während derer Clément völlig allein war, hätte er tun und lassen können, was er wollte, nur darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen (Unordnung in den Schubladen, Parfümfläschchen oder Porzellanfigürchen, von denen er nicht mehr wüsste, an welcher Stelle sie zu stehen hatten, Scherben gar oder Brandschäden in der Küche – etwas, was allen Kindern irgendwann widerfährt). Clément jedoch saß währenddessen in seinem Zimmer und vertiefte sich in seinen Globus, übte Barrégriffe auf der Gitarre oder machte es sich mit einem Buch auf dem Kanapee im Salon bequem. Niemals, auf keinen Fall hätte er es gewagt, etwa in das Ordonanzzimmer der Tante einzudringen, um endlich herauszufinden, was eine Heilpraktikerin machte, oder gar die Tür zum Schlafzimmer der Tante zu öffnen – nichts lag ihm ferner als dies.
Da er nun aber gerade darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass er sich bisher noch nicht gefragt hatte, wie es kam, dass Jeanne an einem Samstagmorgen im Nachthemd am Frühstückstisch saß, und dabei wunderte er sich über sich selbst, seine Naivität, seine Unschuld. Wenn sie am Morgen zum Frühstück zur Tante gekommen ist, warum sollte sie sich dann ausgekleidet und ein Nachthemd angezogen haben, ihr eigenes Nachthemd offensichtlich. (Und er ließ dabei die unmögliche Möglichkeit außer Acht, dass sie bereits im Nachthemd erschienen war.) Wenn dies aber nicht der Fall war, dann musste sie in der Wohnung übernachtet haben – doch wo? Nicht auf dem Kanapee, soviel war klar, auch nicht im Heilpraktiker-Sprechzimmer, wohl auch nicht in der Küche oder in der Badewanne. Es gab nur eine Möglichkeit: Jeanne war angekommen, als er schon geschlafen hatte, und sie hatte im Schlafzimmer seiner Tante übernachtet. In ihrem Bett? Er öffnete sein Buch und las dort weiter, wo er aufgehört hatte.
Mit der Zeit ergab es sich, dass Jeanne nicht mehr nur samstags am Frühstückstisch saß, und ihr Verhalten verlor das Bedachte, Diskrete, sie steigerte die Anzahl der Besuche und verstärkte die Offensichtlichkeit des vertrauten Umgangs, wie man die Dosis eines Mittels steigert, dessen Wirkung einem noch nicht gewiss ist, vorsichtig tastend. Jedenfalls ging sie bald ein und aus, wann immer sie selbst und Tante Thérèse es für angebracht hielten, ein und aus ging sie auch durch die Schlafzimmertür. Beide Frauen beobachteten wohl Clément genauestens, doch er schien nichts bemerken, sich nicht wundern zu wollen. Keine Fragen, nie. »Guten Morgen, Jeanne« begrüßte er sie und trank schnell seine Schale Milchkaffee aus, wenn er wieder einmal spät dran war, »Salut, Jeanne« begrüßte er sie am Abend, jetzt schon im vertrauten, nachlässigen Ton, wenn sie die Wohnungstür mit ihrem eigenen Schlüssel aufschloss (auch das hatte er als graduelle Veränderung des Maßes an Familiarität registriert) und ins Schlafzimmer ging, um sich umzukleiden. Der Hausanzug mit den Blumen im japanischen Stil auf dem Rücken war für ihn fortan der Inbegriff der Intimität, der sie alle drei umfasste.
Er träumte wieder. Es war, als ob Tamatoa und Vahinetua, seine Traumgefährten, mit seinem Umzug von St. Didier-les-Saules nach Dijon die Verbindung zu ihm vorübergehend verloren hätten. »Tāu hōho’a te mou«, erklärte ihm Vahinetua aufgewühlt, und Clément antwortete überflüssigerweise: »Pou i’ō nei«, denn sie hatten ihn ja gefunden. »I’ō nei ora vau«, fügte er vorsichtshalber hinzu, damit sie wussten, dass sie ihn nicht so bald wieder suchen mussten. Seine Traumgefährten lächelten. Vahinetua trat auf ihn zu und umarmte ihn, so dass er ihren Körper an seinem spürte, sie strich ihm über den Kopf, küsste seine Wange und ließ eine Hand über seinen Rücken gleiten. Er war sofort wach und fühlte sich dabei ungewöhnlicherweise so, als hätte er sich gerade aus einem Alptraum befreit. Clément spürte den feuchten Abdruck ihrer Lippen auf seiner Wange und ihre Körperwärme auf seiner Haut, doch ihr Bild war schon fern, verblasste im Dunkel seines Zimmers. Er fühlte sich seltsam erregt, bedrängt, bedroht und beglückt zugleich, ein Wirrwarr aus Eindrücken, die er so noch nie erlebt hatte. Die Begegnung, obgleich nur sekundenlang, stand ihm in allen Details lebhaft vor Augen, sie kam ihm natürlich und selbstverständlich vor, gleichzeitig argwöhnte er, dass das, was zwischen ihm und Vahinetua geschehen war, auf unbestimmte Art nicht in Ordnung sei. Und doch bemühte er sich, das Traumbild zurückzuholen, es gelang ihm und noch einmal war er Vahinetua so nah wie nie. Sie umgab ihn, war an seinem Rücken, an seiner Wange, dann an seiner Brust, zwischen seinen Beinen. Dann fühlte er sich mit einem Mal auf einer Woge blauesten Wassers emporgehoben, sein Herz klopfte so heftig, dass man es nebenan im Schlafzimmer der Tante hören musste, eine Welle angenehmer Wärme rollte durch seine Blutbahnen, und er ergab sich dem, was ihm jetzt widerfuhr, zum ersten Mal in seinem Leben.
Читать дальше