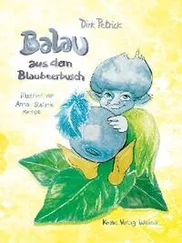»Du kommst nicht mit aufs Collège?«
»Ich wäre sowieso nicht nach Dijon gegangen, sondern wie alle anderen nach Sémur. Warum musst du eigentlich nach Dijon?«
»Mein Vater meint, damit ich nicht jeden Tag fahren muss, außerdem wohnt eine Cousine von Mama in Dijon, bei der werde ich wohnen.«
»Spannend …« antwortete das Mädchen, »wir werden uns also nie mehr sehen?«
Clément hob wieder die Schultern. »Wer weiß …«
»Ja, wer weiß. Vielleicht ist ja irgendwo schon vorgezeichnet, dass wir uns eines Tages wieder begegnen.«
»Kann schon sein.« Sie standen nebeneinander und schauten in das wirbelnde Wasser, undurchsichtig braun nach all den Regenfällen, schäumend an den Steinen und unruhig vorwärts stürmend. Anne-Laure nahm seine Hand, ohne ihn dabei anzuschauen, sie war heiß wie seine, und sie hielt ihn ganz fest. Da fasste er einen Entschluss.
»Nana, ich muss dir was erzählen.«
»Schieß los!«
»Ich träume immer wieder denselben Traum, eigentlich schon seit Jahren.« Er stockte, aber das Mädchen schwieg. »In dem Traum spreche ich eine fremde Sprache, die ich nicht kenne. Ich hab’ so was noch nie gehört, mein ganzes Leben noch nicht. Aber ich verstehe alle und kann mich mit den Leuten, die im Traum auftauchen, unterhalten.«
»Das ist doch toll!« ermunterte ihn Anne-Laure. »Besser als Leute, die mit Äxten und Messern hinter dir herrennen.«
»Träumst du so was?« fragte Clément erschrocken.
»Ach was, aber manche Leute träumen doch solche Sachen.«
»Also, das mit der Traumsprache ist nicht alles.«
»Also doch Hämmer und Kettensägen?«
Clément musste lachen. »Nein, aber ich kann die Sprache auch sprechen, wenn ich wach bin.«
Anne-Laure ließ ihn los und wandte sich ihm zu. »Auch jetzt?«
»Ja, auch jetzt.«
»Das ist ja gigantisch! Sag mal was!«
Clément zierte sich, doch das Mädchen hing an seinen Lippen, also gab er sich einen Ruck. »E nehenehe tō ’oe.« Und weil sie nichts sagte: »’Oe ’ami ’e e vai noa vau hana«
»Was ist denn das?« sie lachte. »Das klingt echt komisch! Und was heißt das?« Und als Clément nicht gleich antwortete: »Nun sag schon!«
»Du bist nett«, nuschelte Clément, »und: Du gehst fort und ich bin traurig«. Sie spürten beide, dass es jetzt das Beste war zu schweigen, bis Clément nach einer Weile gestand: »Nana, das habe ich noch niemandem erzählt, das mit den Träumen.«
»Auch nicht deiner Mama?«
»Nein, niemandem. Und du musst mir versprechen, dass du es niemandem erzählst.«
»Geht klar, du kannst dich drauf verlassen«, versicherte ihm das Mädchen, »ich bin ja sowieso bald fort.«
Sie standen eine ganze lange Weile so da und hingen ihren Gedanken nach. Wenn es nicht so nass gewesen wäre, hätten sie sich gewiss gesetzt, und wenn es nicht so peinlich gewesen wäre, hätte Clément jetzt Nana in den Arm genommen. Aber so sagte sie nur: »Ich geh’ dann mal, vielleicht seh’n wir uns ja noch mal. Salut!«
»Salut!« rief Clément ihr halbherzig hinterher. Wenn er es nicht wirklich besser gewusst hätte, dann hätte er gesagt, dass er sich gerade verliebt hatte.
Und dann kam der Tag, an dem er beschloss, so schnell wie möglich sein Elternhaus zu verlassen, am besten schon gleich, jetzt, auf der Stelle Tante Thérèse zu bitten, ihn aufzunehmen. Es war Samstagnachmittag, Clément hatte seine lässlichen Sünden entlang dem kleinen Beichtspiegel für Kinder in der Dunkelheit des Beichtstuhls bekannt, die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes abgearbeitet und die nörgeligen Litaneien der Frauen des Vereins Kinder der Unbefleckten Maria hinter sich gelassen, da traf er am Kriegerdenkmal auf Edmond und Jeannot. Erst standen sie nur da rum, schwiegen sich an, kickten ein paar Steine hin und her, machten ein paar freche Bemerkungen über die Dörfler, die in die Kirche hineingingen oder herauskamen. Dann zogen sie los, an der Kirche und dem Friedhof vorbei, die Rue de la Croix bis zum Haus des Docteur hinunter, ab in die Wiesen, rüber zum Wäldchen. Sie bewarfen sich eine Weile mit Kiefernzapfen, fochten mit heruntergefallenen Ästen und urinierten jeder an einen Baum. Auf dem Rückweg trafen sie auf Éric, der sie auf seinem Velosolex ein paar Runden drehen ließ. Und dann sagte Jeannot zu Edmond: »Wollen wir piepen gehen?«
Clément bekam sehr wohl mit, dass beide ihn mit einem Seitenblick bedachten, den er nicht zu deuten vermochte, und Edmond entgegnete mit einem Blick auf seine Armbanduhr: »Ist es nicht zu früh?«
»Es ist nie zu früh und selten zu spät«, antwortete Jeannot, und beide brachen in lautes Gelächter aus. Also trotteten sie zurück zum Dorf, Clément immer hinterher.
Bevor sie die Route de Hameau erreichten, setzten sie mit einem Sprung über einen heruntergetretenen Maschendraht und standen im vernachlässigten Gemüsegarten der Witwe Bonnet. Von dort gelangte man durch eine niedrige Holztür, die nur angelehnt war, in die ehemalige Werkstatt des seligen Monsieur, wo es noch nach Metall und Öl roch. Hier kletterten Jeannot und Edmond über eine wacklige Leiter auf den Boden, Clément, der alle Risiken und Möglichkeiten schnell überschlug, unsicher hinterher. In der Giebelfront gab es ein Fenster, das Glas war herausgeschlagen, von hier aus konnte man die Rückfront der Robin’schen Hauses sehen. »Das ist unser Haus«, sagte Clément zaghaft, und die beiden Kameraden schauten ihn verschmitzt an. »Was du nicht sagst!« frotzelte ihn Jeannot. Sie schauten hinüber, aber es gab nichts von Belang zu sehen.
»Ich hab’ doch gesagt, es ist zu früh«, meckerte Edmond.
»Wart’s ab!« war alles, was Jeannot zurückgab.
Beide schauten angespannt nach drüben, als ob sie auf eine Erscheinung warteten. Und genau darum ging es, denn in diesem Moment ging das Licht gegenüber an, und Clément wusste sofort, welcher Raum das war. Das Glas des Badezimmerfensters war geriffelt, wenn man von drinnen nach draußen schaute, sah man die Bäume und die Scheune, in der die Buben jetzt saßen, nur schemenhaft – wenn man nicht wusste, was es da draußen zu sehen gab, konnte man es nicht erkennen. Genauso war es, wenn man von draußen hineinschauen wollte, so glaubten jedenfalls die Robins. Jetzt aber, so musste Clément voller Entsetzen feststellen, da der Raum hell erleuchtet war, hinderte das Riffelglas kaum daran zu sehen, was verborgen bleiben sollte. Clément war wie versteinert, als die beiden anderen weiter voller Spannung gebannt in Richtung des Lichtscheins schauten. Dort erschien Cléments Mutter. Als sie das Badezimmer betrat, konnte man noch nicht viel erkennen, doch ihr Sohn wusste sehr wohl, dass sie den Bademantel trug, das erkannte er am Gelb des Frottees. Sie drehte sich um, ließ den Bademantel von den Schultern gleiten und hängte ihn an die Tür. Edmond gluckste. Jetzt drehte sie sich um und trat näher ans Fenster, und je näher sie kam, umso mehr entzog ihr das Glas seinen Schutz, es war als ob man das verschwommene Bild eines Fernglases allmählich scharf stellte.
Clément schlug das Herz im Hals: Man sah alles. Alles. Und mit einem Schlag wurde ihm bewusst, dass die Schulkameraden seine Mutter schon öfter so gesehen hatten, er jedoch, ihr eigener Sohn, noch nie zuvor. Er war wie gelähmt, schämte sich für seine Mutter, fühlte gleichzeitig jedoch eine seltsame Erregung und wurde darüber unermesslich wütend. Er schlug mit beiden Fäusten auf die Jungs ein, die da vor ihm knieten, aber die lachten nur, und Edmond verpasste ihm schließlich einen Fausthieb, der ihn in den Staub streckte. »Scharfe Braut, deine Mutter!« rief Jeannot, und beide starrten auf das Fenster, durch das sie jetzt Marthe Robin von hinten sahen, wie sie sich vor dem Spiegel nach links und rechts wendete, bevor sie aus dem Bild verschwand, in die Badewanne, wie Clément wohl wusste. Jeannot und Edmond stiegen die Leiter hinunter und glücklicherweise fiel den beiden nicht ein, diese umzulegen und damit Cléments Rückzug zu vereiteln. Der traute sich nicht nach Hause: Wie sollte er jetzt seiner Mutter beim Abendbrot gegenübersitzen, sie um die Milch bitten, aus ihrer Hand die Teller zum Abtrocknen entgegennehmen? Der Gutenachtkuss! durchfuhr es ihn, der war jetzt ein für alle Mal unmöglich geworden.
Читать дальше