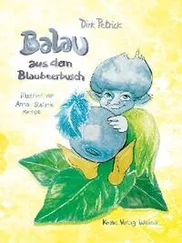Stefan G. Wolf
Aus dem Blau dieses unfassbare Glück
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Stefan G. Wolf Aus dem Blau dieses unfassbare Glück Roman Dieses ebook wurde erstellt bei
Der Traum Der Traum Aus einem Traum war er erwacht, oder träumte er, wach zu sein? War er ein Mensch, der träumte, dass er mit den Fischen schwamm, oder ein gefiederter Fisch, der da flog und hoffte: dies sei kein Traum? Dieses unfassbare Glück, Traum von einem Traum.
Prolog Prolog Wenn man in den Ort im Herzen Burgunds hineinfährt, kommt man – aus welcher Richtung auch immer – unweigerlich zur Kirche Saint Ghislain mit ihrem schiefen Dach. Davor liegt ein abschüssiger Platz, den die zweigeschossigen grauen Sandsteinfassaden mit verschlossener Miene anschweigen und an dessen unterem Ende das kleine Rathaus von St. Didier-les-Saules missmutig hinaufschaut, davor das Kriegerdenkmal. In der oberen Hälfte des Platzes zweigt links eine Gasse ab, schlägt ein Haken nach rechts, und da steht man schon vor dem Anwesen der Familie Robin: Wohnhaus, Hof, Werkstatt, ein paar niedrige Nebengebäude, dahinter ein trostloser Garten. Heute wohnt hier eine Frau aus Paris mit ihrem Freund, der aus Australien oder Neuseeland zugeflogen sein soll. Sie gibt Malkurse, im Sommer ist das Haus voll, viele Frauen, auch einzelne Männer. Dann und wann zieht eine Gruppe, bepackt mit Staffeleien, Mal- und Picknickutensilien früh morgens hinaus in die Natur , manchmal sitzen sie alle im Hof, es wird viel geschwiegen und dann wieder viel gelacht. Was sie sonst so machen, wo sie alle schlafen: Wen interessiert das heute noch? Einmal im Jahr, außerhalb der Saison, veranstaltet Mélanie, die Malerin, eine Ausstellung im Atelier, das mal eine Werkstatt war, »um den Bürgerinnen und Bürgern von St. Didier-les-Saules etwas zurückzugeben«, wie sie sagt. Die kommen auch, schauen sich die Bilder an, trinken ein Glas Wein, das ihnen Neil, der Australier (oder Neuseeländer) eingießt, und gehen wieder. Gekauft hat noch niemand jemals etwas. Wenn sie wieder draußen sind, schauen sich die Leute aus dem Dorf schweigend, aber bedeutungsvoll an. Sie kennen ja alle die Geschichte vom kleinen Clément Robin, der früher hier wohnte und der eines Tages begann, in einer Sprache zu reden, die im Traum zu ihm gekommen sein soll. Ein seltsames Kind, das sich durch nichts und niemanden davon abbringen ließ, dieses Kauderwelsch zu produzieren. Irgendwann war es dann weg. Und viele Jahre später lief Roland, sein Vater – da war er schon ein alter, zuweilen seltsamer Mann – mit einem Brief durchs Dorf, hielt jeden an, der ihm entgegenkam, klopfte da und dort auch an die Haustüren. »Hier«, sagte er, dem sein Sohn schon immer fremd war, und schwenkte den Brief durch die Luft wie eine erbeutete Fahne, »er schreibt: ›Ich habe das Paradies meiner Träume gefunden‹. Heilige Maria, Muttergottes, er hat das Paradies gefunden!«
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vom selben Autor:
Impressum neobooks
Aus einem Traum war er erwacht,
oder träumte er, wach zu sein?
War er ein Mensch, der träumte,
dass er mit den Fischen schwamm,
oder ein gefiederter Fisch, der da flog und hoffte: dies sei kein Traum?
Dieses unfassbare Glück,
Traum von einem Traum.
Wenn man in den Ort im Herzen Burgunds hineinfährt, kommt man – aus welcher Richtung auch immer – unweigerlich zur Kirche Saint Ghislain mit ihrem schiefen Dach. Davor liegt ein abschüssiger Platz, den die zweigeschossigen grauen Sandsteinfassaden mit verschlossener Miene anschweigen und an dessen unterem Ende das kleine Rathaus von St. Didier-les-Saules missmutig hinaufschaut, davor das Kriegerdenkmal. In der oberen Hälfte des Platzes zweigt links eine Gasse ab, schlägt ein Haken nach rechts, und da steht man schon vor dem Anwesen der Familie Robin: Wohnhaus, Hof, Werkstatt, ein paar niedrige Nebengebäude, dahinter ein trostloser Garten. Heute wohnt hier eine Frau aus Paris mit ihrem Freund, der aus Australien oder Neuseeland zugeflogen sein soll. Sie gibt Malkurse, im Sommer ist das Haus voll, viele Frauen, auch einzelne Männer. Dann und wann zieht eine Gruppe, bepackt mit Staffeleien, Mal- und Picknickutensilien früh morgens hinaus in die Natur , manchmal sitzen sie alle im Hof, es wird viel geschwiegen und dann wieder viel gelacht. Was sie sonst so machen, wo sie alle schlafen: Wen interessiert das heute noch? Einmal im Jahr, außerhalb der Saison, veranstaltet Mélanie, die Malerin, eine Ausstellung im Atelier, das mal eine Werkstatt war, »um den Bürgerinnen und Bürgern von St. Didier-les-Saules etwas zurückzugeben«, wie sie sagt. Die kommen auch, schauen sich die Bilder an, trinken ein Glas Wein, das ihnen Neil, der Australier (oder Neuseeländer) eingießt, und gehen wieder. Gekauft hat noch niemand jemals etwas.
Wenn sie wieder draußen sind, schauen sich die Leute aus dem Dorf schweigend, aber bedeutungsvoll an. Sie kennen ja alle die Geschichte vom kleinen Clément Robin, der früher hier wohnte und der eines Tages begann, in einer Sprache zu reden, die im Traum zu ihm gekommen sein soll. Ein seltsames Kind, das sich durch nichts und niemanden davon abbringen ließ, dieses Kauderwelsch zu produzieren. Irgendwann war es dann weg. Und viele Jahre später lief Roland, sein Vater – da war er schon ein alter, zuweilen seltsamer Mann – mit einem Brief durchs Dorf, hielt jeden an, der ihm entgegenkam, klopfte da und dort auch an die Haustüren. »Hier«, sagte er, dem sein Sohn schon immer fremd war, und schwenkte den Brief durch die Luft wie eine erbeutete Fahne, »er schreibt: ›Ich habe das Paradies meiner Träume gefunden‹. Heilige Maria, Muttergottes, er hat das Paradies gefunden!«
Clément war gerade dem Unbewussten der frühen Kindheit entwachsen, als sich erstmals in die Schwaden des unerinnerten Graus, die seine Träume durchzogen, hier und da erleuchtet von grellen Blitzen, die ihn gerade genug erschreckten, dass seine kleinen Fäuste das Kissen fassten und er sich umdrehte, um weiter durch die Nebel des Schlafs zu taumeln, zunehmend Wirbel und Wellen von Grün, Türkis und Blau aller Schattierungen mischten, die aus dem unendlichen Raum der Traumwelten zu ihm kamen. Nicht Nacht für Nacht, aber immer wieder über die Wochen dieses ungewöhnlich milden, dann plötzlich frostig-kalten Herbstes hinweg verdrängte die blau-grüne Drift die Nebel seiner Kinderträume. Wenn Clément dann erwachte, fand er sich wieder in einer trüben, farblosen Welt, und schloss schnell die Augen, um noch einmal einzutauchen in das warme Leuchten.
Machte er sich morgens auf den Schulweg, begleiteten ihn bis hinter Bertrands Ziegenstall das Singen der Bandsäge und die dumpfen Hammerschläge, mit denen Roland Robin die Bretter ineinanderfügte. Seit Clément wusste, dass sein Vater, wie schon sein Großvater und dessen Vater, Särge zimmerte und wozu sie dienten, klangen die Geräusche aus der Werkstatt hinter dem Wohnhaus anders, ohne dass Clément darüber nachdachte, wie er das beschreiben sollte – anders eben. Es sollte nicht lange dauern und der Vater würde zum ersten Mal einen Verstorbenen aus einem Trauerhaus holen, um ihn in einem Raum hinter der Werkstatt ordentlich einzusargen, denn in den neuen Mietshäusern am Rand des Nachbarorts war die Möglichkeit für die alten Bräuche (das Aufbahren, die Totenwache) nicht mehr ohne Weiteres gegeben. Von da an nannte sich sein Vater ein wenig großspurig Bestatter und verbarg die Schwielen und blutigen Risse seiner Hände, so gut es ging, aber das sollte noch eine Zeit dauern, und bis dahin änderte sich für Clément und seine Gedanken über die Werkstatt, den Duft des Holzes und das Kreischen der Kreissäge noch nicht allzu viel.
Читать дальше