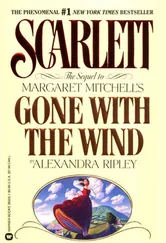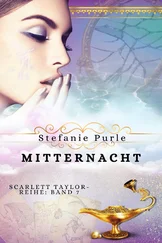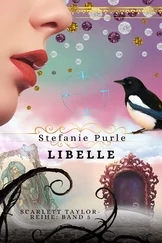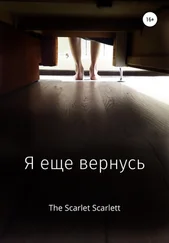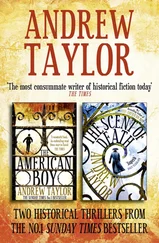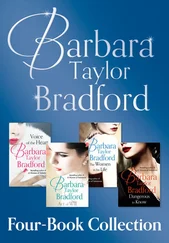„Was erzählst du deiner Mutter denn für Gruselgeschichten?“, fragt eine heitere Stimme, als die Tür aufschwingt. Es ist Schwester Tanya, sie lächelt und läuft auf mich und Mutter zu.
„Ach, ich habe ihr nur erzählt, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe“, lüge ich und lächle zurück.
Tanya beugt sich zu meiner Mutter vor und streicht ihr über den Unterarm. „Na, Hauptsache, Sie können gleich noch gut schlafen, Frau Schneider“, sagt sie und zwinkert mir zu. Als sie den leeren Teller auf dem Tisch sieht, nickt sie anerkennend. „Sie haben ja alles aufgegessen! Sehr gut!“ Sie nimmt das Tablett hoch und macht sich zum Gehen auf. Bevor sie durch die Tür in den Flur tritt, wendet sie sich an mich. „Du klingelst, wie immer, wenn du gehst, ja? Dann legen wir sie zum Mittagsschlaf hin.“
Ich nicke und bedanke mich. Mutter blinzelt.
Nach ein paar stillen Minuten, in denen ich sie dabei beobachtet habe wie sie ins Nichts blickt, nehme ich ihre Hand und streiche über ihre pergamentartige Haut.
Sie anzuflehen, damit sie zurückkommt, zu jammern und zu weinen, damit sie auch nur eine kleine Regung von sich gibt, habe ich vor Jahren aufgegeben. Ich weiß, sie würde wieder zurückkommen, wenn sie könnte. Aber sie kann nicht. Aus irgendeinem Grund ist sie seit über neun Jahren in dieser Situation gefangen.
Ziemlich oft denke ich an den Tag zurück, an dem es passiert ist, an dem sie zwar wach wurde, aber nicht mehr aufwachte. In meinen Gedanken habe ich diesen Tag Millionen Male Revue passieren lassen. Es war der Tag vor meinem achtzehnten Geburtstag. Mutter, Elvira, ein paar Freundinnen und ich hatten die Tage zuvor mit der Planung der Feier verbracht. Da mein Vater uns noch vor meiner Geburt verlassen hatte, waren unsere finanziellen Mittel begrenzt, aber das hat Mama mich nie spüren lassen. Sie machte alles möglich, und dieser Geburtstag sollte etwas ganz Besonderes werden.
An dem besagten Tag war ich schon früh wach. Mama hatte die halbe Nacht damit verbracht, aus einem zerbrochenen Spiegel, einem alten Ball und einer Heißklebepistole eine Discokugel für die Party zu basteln. Das Ding lag fertig auf dem Küchentisch, glitzernd, rund und perfekt. Ich konnte nicht glauben, dass sie es noch in der Nacht fertiggestellt hatte und hüpfte aufgeregt in ihr Zimmer, um mich zu bedanken. Sie schlief noch, also sprang ich auf ihr Bett. Ich sang ein dämliches Lied, um sie zu ärgern und wach zu kriegen, während ich auf und ab sprang. Aber sie reagierte nicht.
Selbst wenn ich heute daran denke, wird mir noch flau im Magen.
Der Moment, als ich dachte, sie sei tot.
Als ich mich herunterbeugte, ihr Gesicht in beide Hände nahm, ihren wirren Blick sah.
Die Minuten, in denen ich vergeblich versuchte einen Puls zu fühlen, ich aber nicht wusste wie es richtig geht und schließlich mein Ohr auf ihre Brust presste.
Die Verwirrung, als ich zwar ein Herz schlagen hörte, meine Mutter aber trotzdem wie tot dalag...
Ich hatte ihr schon kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt, geschrien, ihr eine Ohrfeige verpasst und verzweifelt auf dem Boden vor ihrem Bett geweint, bis ich endlich auf die Idee kam, Elvira anzurufen.
Danach verblasst meine Erinnerung. Alles ist in grauen Nebel gehüllt.
Ich musste unsere Wohnung verlassen und kam im Wohnheim unter. Mehrmals pro Woche war ich bei Elvira, und genauso oft ging ich meine Mutter in der Klinik besuchen.
In den ersten Jahren habe ich sie angefleht zu mir zurückzukommen, etwas zu sagen, wieder zu reagieren. Doch irgendwann hörte ich damit auf. Was, wenn sie zurückkommen will, aber es nicht kann? Wie muss sie sich fühlen, wenn ihre Tochter sie um etwas anfleht, das sie ihr nicht geben kann? Also hörte ich auf zu betteln und arrangierte mich mit allem.
Aber in Momenten wie diesen, könnte ich wirklich ihren Rat gebrauchen. Ich wünschte, sie würde plötzlich wieder erwachen und mir sagen, was ich zu tun habe. Aber das tut sie nicht. Stattdessen schaut sie aus dem Fenster.
Ich lege ihre Hand in ihren Schoß, löse die Handbremse vom Rollstuhl und schiebe sie hinaus auf die Terrasse in die Sonne. Ich fahre sie in den Halbschatten, wo die warme Sonne auf ihre Beine strahlt, sie aber nicht blendet. Dann hole ich eine kleine Decke und mein Buch von Elvira, setze mich neben meine Mutter und lese dort weiter. Irgendwo, zwischen all diesen wirren Notizen muss stehen, wie ich Zoe und Julie helfen kann. Ich blättere vor und zurück, suche nach Schlagworten wie „Schattenwesen“, „Geist“ oder etwas in der Art, als ich schließlich über eine nachträglich hineingeklebte Zeichnung stolpere. Meine Finger zittern leicht, als sie über das grausige Bild fahren. Darauf ist eine Gestalt aus Schatten zu sehen, mit breiten Schultern, schmalem Kopf, krummen Beinen und langen Armen. Das Schlimmste aber ist das Grinsen. Diese Zeichnung grinst genauso, wie das Ding in Zoes Haus. Sein Kopf wirkt wie horizontal zu einem fiesen Lachen gespalten.
Ich bedecke die Zeichnung mit der flachen Hand, weil ich es nicht länger ertragen kann sie zu betrachten. Auch wenn es nur eine Zeichnung ist, so sitzt der Schock noch zu tief. Ich frage mich, ob diese Zeichnung der Beweis dafür ist, dass das, was ich gesehen habe, echt war.
Neben dem eingeklebten Bild steht etwas vertikal geschrieben. Ich drehe das Buch und lese es.
„ Dämon!!! Nichts auf eigene Faust unternehmen! Chris anrufen! Nummer im Handy !!!“
Nachdem ich mich von meiner Mutter verabschiedet habe, fahre ich nach Hause. Die Nummer von diesem Chris steht tatsächlich in dem Handy, welches Elvira mir hinterlegt hat. Darunter der Vermerk „ Dämonologe “.
Ich habe keine Ahnung was ich sagen soll, wenn ich ihn anrufe. Wird er mich für verrückt halten, oder hat er schon Schlimmeres gehört?
Ich steige aus meinem schwarzen Panther und höre hinter mir ein anerkennendes Pfeifen. Als ich mich umdrehe, steht dort mein arroganter, namenloser Nachbar. Ich stöhne genervt und krame meine Sachen zusammen.
„Neues Auto, Schneider? Hast du im Lotto gewonnen, oder was?“, fragt er, die Arme vor der Brust verschränkt, als er langsam auf mich zuläuft. „Nicht schlecht, Sommersprosse!“
Ich kann gar nicht so viel seufzen und mit den Augen rollen, wie ich gerne würde. „Danke“, murmle ich und laufe mit meinen Sachen im Arm an ihm vorbei.
„Ganz in Schwarz heute? Gibt es was zu betrauern? Soll ich dir Trost spenden?“, säuselt er und setzt einen lächerlichen Hundeblick auf, mit gesenkten Lidern und gespitzten Lippen, während er neben mir hertrottet.
Ich lehne dankend ab und krame den Haustürschlüssel aus meiner Manteltasche. Mein Nachbar lehnt sich an die Hauswand, dicht neben mir, kratzt sich den Hinterkopf und lugt auf die Sachen in meinem Arm. Ich presse sie noch dichter an mich, um sie vor seinen neugierigen Blicken zu schützen.
„Was hast du da?“, will er wissen, beugt sich vor und deutet mit dem Finger auf mein Buch. Seine Augen weiten sich und er saugt die Luft ein. „Hat das Moppelchen etwa endlich wieder einen Job?“ rät er und grinst mich an.
„So in etwa“, antworte ich knapp und husche durch die Tür. „Und nenn mich nicht Moppelchen!“
Er bleibt mir dicht auf den Versen, hüpft leichtfüßig die Treppen neben mir hoch und lächelt mich dabei an. „Erzähl doch mal, Schneider. Es scheint ein guter Job zu sein, wenn ich mir so deinen neuen Wagen anschaue“, bohrt er auf seine lästige Art weiter, während er um mich herumtänzelt.
Vor meiner Wohnungstür bleibe ich stehen, wende mich ihm zu und zwinge mich, ihm fest in die stahlblauen Augen zu sehen. „Das geht dich nichts an!“, sage ich bestimmt und straffe die Schultern.
Er weicht keinen Zentimeter zurück und begegnet meinem Blick. Offenbar denkt er nach, wobei er immer noch dieses schiefe Grinsen auf den Lippen trägt.
Читать дальше