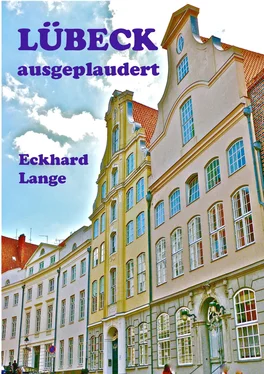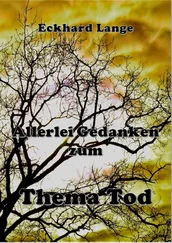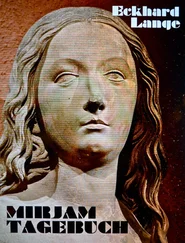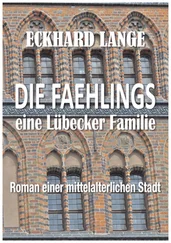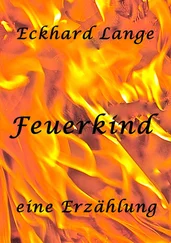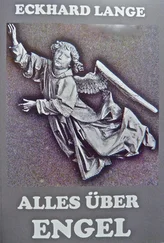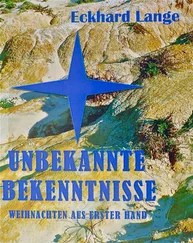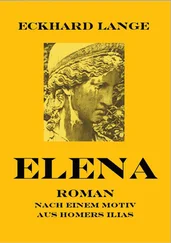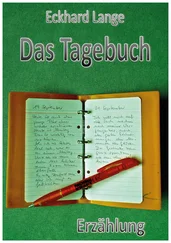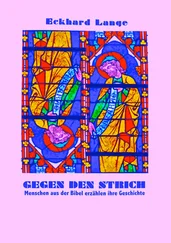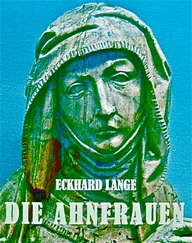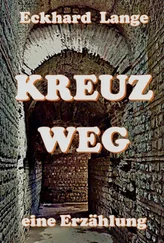Das nötige Vermögen hatte er aus Bardowiek mitgebracht, und es half ihm auch, möglichst rasch den Eid auf den Rat abzulegen, um die Bürgerrechte zu erhalten. Sein Weib, die zwei Söhne und drei Töchter waren ihm gefolgt, und für Trineke, die jüngste, hatte er schon einen Vertrag mit der Oberin des gerade erst geweihten Johannesklosters geschlossen, falls er sie nicht unter die Haube bringen konnte. Hinrich, sein Ältester, war schon fast erwachsen und würde ihn bald auch auf seinen Fahrten begleiten können. Denn Johann hatte vor, seine Geschäfte auszuweiten: Schon aus Bardowick hatte er Anteile an drei lübischen Schiffen erworben, und auf einem wollte er sich zum ersten Mal in seinem Leben auf die stürmische See begeben.
Vorsorglich hatte er beim Rat ein Testament hinterlegt, bezeugt von zwei Ratsherren, und außerdem dem Altar des Heiligen Nikolaus als Schutzpatron der Schiffer zwei große Wachskerzen gestiftet. Übrigens war Nikolaus gleichsam umgezogen: Der Herzog hatte dem Wunsch des Oldenburger Bischofs stattgegeben, den Sitz des Bistums nach Lubeke verlegen zu dürfen, hatte ihm Grund und Boden im Süden des Stadthügels geschenkt und dort ein erstes, noch recht bescheidenes Oratorium errichten lassen, damit Bischof und Domherren die Messe feiern konnten.
Vor allem aber hatte er einige Jahre später feierlich den Bau eines steinernen Domes begonnen, einer Basilika von beträchtlichem Ausmaß, wie sie einem Bischof gebührte. Selbst der Erzbischof aus dem fernen Bremen war angereist, um der Weihe des Grundsteins die nötige Würde zu geben.
Und der Backstein imponierte anscheinend dem Herzog als Baumaterial, so dass er ihn nicht nur für seine Burg im Norden der Halbinsel verwendet, wo diese Ziegel bis auf den heutigen Tag das Fundament am Burgtor bilden. Er nutze sie einige Zeit später, als er schon den Zorn seines kaiserlichen Vetters zu spüren bekam, auch für die bürgerliche Civitas, also den besiedelten Teil auf der Mitte des Hügels, die er nun mit einer Backsteinmauer gegen einen befürchteten Angriff sicherte.
Um auf Johann zurückzukommen: Er plante also, die Insel Gotland anzusteuern, denn der Herzog hatte nicht nur den Gotländern zollfreien Handel in seinen Territorien zugesichert, sondern im Gegenzug auch die Rechte seiner lübischen Kaufleute dort auf der Insel gefestigt – ein weitsichtiges Abkommen war so 1160 zustande gekommen. Wir berichteten bereits davon, Die Schwurgemeinschaft der deutschen Gotlandfahrer hatte nun feste Häuser und einen ständigen Vertreter dort auf der Insel, gleichsam einen zollfreien Hafen und eine exterritoriale Siedlung. Auf Gotland landeten die Nordmänner schließlich alle Waren an, die sie aus Nowgorod und von den Häfen der Esten und Kuren herbeibrachten.
Aber der Schiffsführer, dem sich Johann anvertraut hatte, wollte mehr: selbst von Gotland aus die ferne Küste ansteuern, hinter der dieses sagenhafte Nowgorod lag – ein großes Abenteuer, aber eine ebenso große Chance, den Gewinn ohne den Zwischenhandel um ein vielfaches zu steigern. So konnten die mitgeführten flandrischen Tuche und die Schwerter und Helme westfälischer Werkstätten direkt gegen Zobel und Marder, aber auch gegen Teer und Wachs getauscht werden.
Lassen wir es also dahingestellt, ob unser guter Johann gesund und mit reichem Gewinn seine Reise beendet hat oder doch in Visby von einem rauflustigen Gotländer erschlagen wurde oder gar in den Tiefen der Ostsee inmitten eines Schiffswracks auf die Auferstehung des Leibes wartet, an die er sicher fest geglaubt hat. Vielleicht aber begegnen wir seinem Sohn oder Enkel ja noch einmal im Laufe der Geschichte.
5. Lübeck – Stadt der sieben Türme
Zugegeben, Köln hatte im Mittelalter weitaus mehr Kirchen als Lübeck, aber Köln war auch jahrhundertlang die größte Stadt des Reiches nördlich der Alpen – und übrigens auch der Ursprungsort der Hanse. Aber davon später. Doch mit seinem Dom, den vier Pfarrkirchen, vier Klöstern, einem Spital und einigen Kapellen konnte die ja erst viel später entstandene Stadt an der Trave sich schon sehen lassen. Sieben Türme, ihr heutiges Markenzeichen, hatte sie damals allerdings noch nicht. Und wir hatten es schon gesehen: Die Anfänge des Kirchbaus waren noch äußerst bescheiden: Hölzerne Kirchlein, wohin man blickte. Aber schon bald – anders als die ersten Feldsteinkirchen in Wagrien – entdeckte man (wieder) ein solides Baumaterial: den Ziegel, oder, wie man gemeinhin hier entlang der Ostsee sagt: den Backstein.
Steine hatten die Eiszeiten zwar hier und da zurückgelassen, aber nur hartes Felsgestein statt der weiter südlich üblichen und leichter zu bearbeitenden Sand- oder Kalksteine. Ton dagegen gab es in großen Lagern, längs der Trave gleich vor der Stadt, und bald wurden die Holzbauten durch Backsteinkirchen ersetzt. Noch waren es romanische Basiliken, eintürmig und massiv. Aber Herzog Heinrich plante für das Lübecker Bistum schon eine Kathedrale, zweitürmig, wie es sich für eine Bischofskirche gehörte, ähnlich dem Dom seiner Residenzstadt Braunschweig. 1173 hatte er gemeinsam mit Bischof Gerold den Grundstein gelegt – wir wissen es schon - und zugleich für den Bau eine jährliche Gabe von 100 Mark gestiftet – damals eine beträchtliche Summe, zumal der Löwe ja auch andere Bistümer im slawischen Missionsgebiet förderte: Ratzeburg und Schwerin.
Es war mit den 92 Metern in der Länge der erste Großbau, den man allein mit den kleinen Ziegelsteinen aufführen wollte, und entsprechend mächtig mussten Wände und Pfeiler werden. Der Bau zog sich hin, nicht nur, weil die vielen Backsteine mühsam genug produziert werden mussten, sondern auch wegen der unsicheren politischen Verhältnisse, nachdem der Löwe gestürzt und das Herzogtum zerschlagen war. Erst 1247 konnte der Dom geweiht werden - fast hundert Jahre später. Knapp zwei Jahrzehnte danach jedoch reichte er den Bischöfen nicht mehr, denn sie unterlagen einem ständigen Konkurrenzdruck im Vergleich mit der Kirche des Rates, St. Marien.
...................................................................................................................................
Vor jeder Sitzung versammelte sich der Rat in der Marienkirche, um der heiligen Messe zu lauschen, bevor er ins Rathaus hinüberging. Doch heute ist es anders: Statt schweigend in den Ratssaal zu schreiten, hält Wilhelm Witte seinen Ratskollegen Heinrich von Bockholt zurück: „Auf ein Wort, Heinrich! Habt Ihr bemerkt, wie düster unsere Kirche heute wieder gewirkt hat?“ - „Es ist neblig, da mag es wohl so scheinen,“ erhält er zur Antwort.
„ Nein, das ist es nicht: Die kleinen Fenster, dieser ganze Bau - das ist doch nicht mehr unserer Zeit angemessen. Da baut man im fernen Frankreich längst anders.“ - „Wilhelm, haben wir nicht die alte Basilika gerade erst zu einer weiten Halle umgebaut, wie man es in Westfalen getan hat? Und unser Werkmeister mit seinen Leuten ist noch lange nicht fertig. Wie sollen wir seine Pläne da noch einmal ändern?“ Herr Wilhelm schaut den anderen mit geheimnisvoller Miene an: „Wir müssen jetzt eilen, die anderen sind schon durchs Tor. Aber ich bitte Euch heute nach dem Angelusläuten zu mir, da möchte ich Euch zeigen, was ich von der letzten Reise nach Flandern mitgebracht habe.“
Heinrich von Bockholt ist neugierig geworden, so schreitet er eilig die Alfstraße hinunter, um Wilhelm Witte zu besuchen, kaum, dass die Glocken im Turm von St. Marien verklungen sind. Der Ratsherr erwartet ihn schon, führt ihn in seine Dornse und öffnet eine Truhe, um eine große Rolle zu entnehmen. Er breitet sie auf dem Pult aus und wartet schweigend, dass sein Gast die Zeichnung betrachtet.
Dann blickt Heinrich auf: „Das ist gewaltig,“ sagt er ehrfürchtig, „aber glaubt Ihr wirklich, eine solche Kirche kann man bauen? Die riesigen Fenster in den Wänden, dieser ganze Zierat! Und dann diese Türme, als ob sie den Himmel berühren! Das kann kein Werkmeister zustande bringen.“
Читать дальше