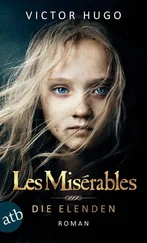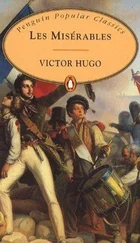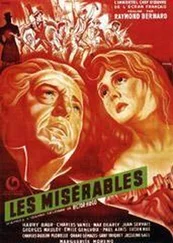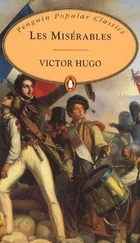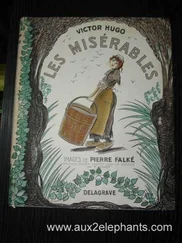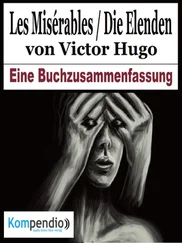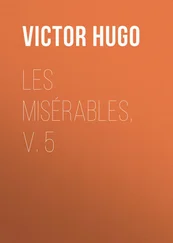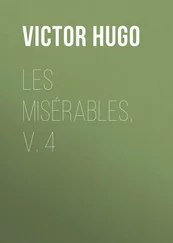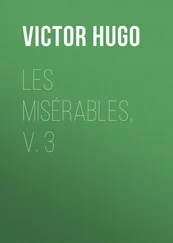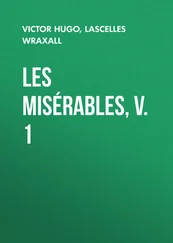Der Bischof begriff dies, die Zeit drängte, als Priester war er doch gekommen. Die ursprüngliche Abneigung war allmählich in das entgegengesetzte Extrem, in die tiefste Rührung übergegangen; er blickte auf die geschlossenen Augen, die eiskalte runzlige Hand des Sterbenden und beugte sich zu ihm nieder:
»Dies ist die Stunde Gottes. Nicht wahr, es wäre bedauerlich, wenn wir umsonst zusammengekommen wären?«
Der Sterbende schlug die Augen auf. Auf seinem Antlitz lag ein Ausdruck von würdevollem Ernst, aber mit einem Anflug von Mißmuth.
»Herr Bischof,« sagte er und seine Worte kamen langsam hervor, wohl mehr vom Gefühl seiner Würde getragen, als weil seine Kräfte ihn verließen, »mein ganzes Leben war dem Studium und der Betrachtung geweiht. Ich war sechzig Jahre alt, als mein Vaterland mich rief und mir befahl, mich mit seinen Angelegenheiten zu beschäftigen. Ich gehorchte. Es bestanden Mißbräuche, ich habe sie bekämpft; Unterdrückung, ich habe sie beseitigt; Rechte und Grundsätze, ich habe mich ihrer angenommen. Feindliche Armeen drangen in Frankreich ein, ich wagte mein Leben um es zu vertheidigen. Ich war nicht reich und bin arm geblieben. Ich war einer der Herren des Staates, die Keller des Schatzes waren mit Gold und Silber erfüllt, so daß die Mauern gestützt werden mußten, – ich speiste in der Rue de l'Arbre-Sec für zweiundzwanzig Sous. Ich habe die Unterdrückten befreit und den Unglücklichen geholfen. Ich habe Altartücher zerrissen, aber nur um die Wunden des Vaterlands zu verbinden. Ich habe immer den Drang des Menschengeschlechts nach dem Lichte unterstützt und bisweilen mich dem Fortschritt entgegengestemmt, wenn er kein Erbarmen hatte. Ich habe gelegentlich meine Feinde, Euch Priester, beschützt. Da ist zu Petegsem in Flandern, an demselben Ort, wo die merowingischen Könige ihren Winterpalast hatten, ein Urbanistinnenkloster, die Abtei der heiligen Klara, die ich 1793 gerettet habe. Ich that meine Pflicht nach Maßgabe meiner Kräfte und so viel Gutes, wie ich konnte. Nachher bin ich verbannt, gehetzt, verfolgt, drangsalirt, verleumdet, verhöhnt, verflucht, proskribirt worden. Seit Jahrzehnten sehe ich, daß viele Leute mit Verachtung auf mich herabsehen, die arme unwissende Menge sieht auf meinem Gesicht Merkzeichen künftiger Verdammniß und ich ertrage, ohne zu hassen die Einsamkeit eines allgemein Gehaßten. Jetzt bin ich sechsundachtzig Jahre alt und im Begriff zu sterben. Was wollen Sie nun von mir!«
»Ihren Segen,« bat der Bischof und kniete nieder.
Als er den Kopf wieder aufrichtete, hatte das Gesicht des ehemaligen Conventsmitgliedes einen erhabenen Ausdruck angenommen. Er war verschieden. Der Bischof ging nach Hause, tief in Gedanken versunken und brachte die ganze Nacht im Gebet zu. Am nächsten Tage versuchten einige neugierigen Leutchen ihn über das Conventsmitglied G. auszufragen, aber statt aller Antwort zeigte er nach dem Himmel. Von derselben Zeit an bezeigte er den kleinen Leuten und den Unglücklichen noch einmal so viel Sanftmuth und Mildthätigkeit.
Jede Anspielung auf den »alten Halunken« den G. versetzte ihn in eigentümlich tiefes Nachdenken. Niemand weiß zu sagen, ob nicht die Begegnung mit einem weisen und edlen Manne von anderer Sinnesart, als der seinigen, ihn in seinem Streben nach Vollkommenheit bestärkte.
Natürlich gab dieser »Seelsorgerbesuch« Anlaß zu allerlei Gerede:
»Gehört denn ein Bischof an das Sterbebette eines solchen Menschen hin? Augenscheinlich stand eine Bekehrung ja doch nicht zu erwarten. Die Revolutionäre sind insgesammt rückfällig. Warum ist er also zu ihm gegangen? Was hatte er bei ihm zu suchen? Ist er denn so neugierig, daß er durchaus einmal dabei sein mußte, wenn der Teufel eine Seele holt?«
Eines Tages schoß eine alte Schachtel, eine von jenen, die ihre Ungezogenheit für Witz halten, folgende Bosheit auf ihn ab:
»Alle Welt ist neugierig, wann Ew. Bischöfliche Gnaden die rothe Mütze bekommen werden.«
»Oh, oh,« versetzte er, »das ist eine schlimme Farbe. Glücklicherweise achten Diejenigen sie, die sie an einer Mütze hassen, desto mehr an einem Hute.«
Man würde sich sehr täuschen, wenn man aus dem eben Erzählten schließen wollte, unser Bischof sei ein Philosoph oder ein »patriotischer Landgeistlicher« gewesen. Seine Begegnung mit dem Conventsmitgliede G. hinterließ bei ihm eine Art tiefes Erstaunen, das ihn noch weicher stimmte. Weiter nichts.
Obgleich Se. Gnaden Herr Bienvenu nichts weniger, als ein Politiker gewesen ist, ist hier vielleicht der Ort in aller Kürze anzugeben, wie er sich zu den Ereignissen der damaligen Zeit gestellt hat, vorausgesetzt, daß es. Se. Gnaden Herrn Bienvenu überhaupt beigefallen ist, Stellung zu irgend etwas zu nehmen.
Gehen wir also einige Jahre zurück. Kurze Zeit nach seiner Berufung zum Bischof hatte ihn der Kaiser zum Baron gemacht, zugleich mit mehreren andern Bischöfen. Bekanntlich fand die Verhaftung des Papstes in der Nacht vom 5. zum 6. Juli 1809 statt, und bei dieser Gelegenheit wurde Myriel von Napoleon in die zu Paris versammelte Synode der französischen und italienischen Bischöfe berufen. Diese Synode hielt ihre erste Sitzung am 15. Juni 1811 in der Notredame-Kirche unter dem Vorsitz des Kardinals Fesch. Myriel gehörte zu den Bischöfen, die an dieser Sitzung teilnahmen. Abgesehen von dieser, wohnte er nur noch drei oder vier Konferenzen bei. Als Bischof einer armseligen Gebirgs-Diöcese, der auch selber arm und schlichten Herzens war, brachte er Ideen mit, welche die hohen Herren unangenehm berührten. Er kam sehr bald nach Digne zurück. Wegen seiner eiligen Rückkunft befragt, antwortete er: »Ich war ihnen lästig. Ich brachte Luft von der Außenwelt mit, und kam ihnen vor, wie eine offen stehende Thür.«
Ein anderes Mal bemerkte er: »Die Herren sind Fürsten und ich bin ein armer Bauernbischof.«
In der That hatte er mißfallen. So war ihm u. a., als er sich eines Abends bei einem seiner vornehmsten Kollegen zu Besuch befand, die Aeußerung entschlüpft: »Was für schöne Uhren! Was für schöne Teppiche! Und die Livreen! Solch ein Luxus muß recht lästig sein! Dergleichen Ueberflüssigkeiten möchte ich nicht haben: Sie würden mir immer in die Ohren schreien: Es giebt Menschen, die hungern! Es giebt Menschen, die frieren! Es giebt Arme, Arme!«
Beiläufig gesagt, wäre der Haß des Luxus kein verständiger Haß. Solch ein Verdammungsurtheil würde auch die Künste treffen. Aber bei den Dienern der Kirche ist, abgesehen von der Repräsentation und dem Gottesdienst, der Luxus tadelnswerth. Er ist mit jeder umfassenderen Mildthätigkeit unvereinbar. Ein reicher Priester ist eine contradictio in adjecto. Der Priester soll Verkehr haben mit den Armen. Wie kann man aber unaufhörlich, Tag und Nacht in Berührung kommen mit allerlei Noth und Unglück und Dürftigkeit, ohne daß etwas von diesem Elend haften bleibt, wie Staub an dem Arbeiter? Kann man sich einen Menschen vorstellen, der bei einem Becken voll glühender Kohlen steht, und dem nicht warm ist? Kann man sich einen Arbeiter denken, der fortwährend bei einem Hochofen arbeitet, und dem nie ein Haar verbrannt, ein Nagel geschwärzt wird, dem nie Schweiß die Stirn feuchtet, dem kein Körnchen Asche ins Gesicht fliegt? Der Hauptbeweis einer wahrhaft mildthätigen Gesinnung ist bei einem Geistlichen die Armuth.
So dachte ohne Zweifel der Bischof von Digne.
Man glaube übrigens nicht, daß er über gewisse heiklige Fragen die Ideen seiner Zeit theilte. Er mischte sich wenig in die damaligen theologischen Streitigkeiten und äußerte sich nicht über das Verhältnis der Kirche zum Staat; hätte man aber nachdrücklich in ihn gedrungen, so würde es sich wohl herausgestellt haben, daß er mehr zum Ultramontanismus, als zum Gallikanimus hinneigte. Da wir eine getreue Schilderung entwerfen und nichts Wahres verhehlen mögen, so müssen wir eingestehen, daß Napoleons Niedergang ihn mehr als kühl ließ. Von 1813 an unterstützte er alle oppositionellen Kundgebungen durch seine persönliche Betheiligung oder mit seinem Beifall. Als der Kaiser von der Insel Elba zurückkehrte, lehnte es der Bischof ab ihm seine Aufwartung zu machen und während der Hundert Tage in den Kirchen für ihn beten zu lassen.
Читать дальше