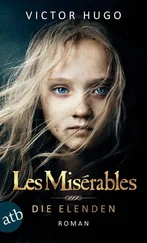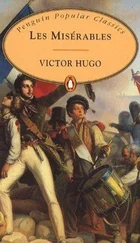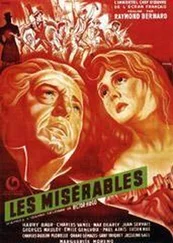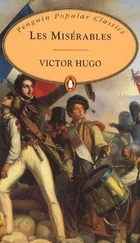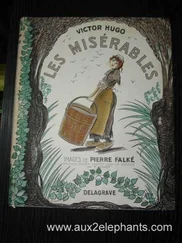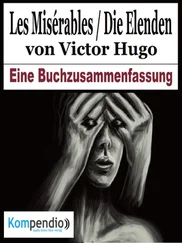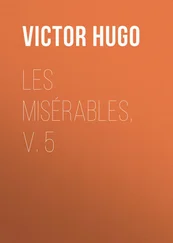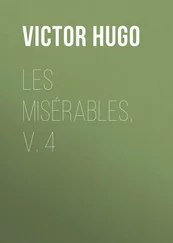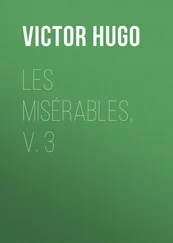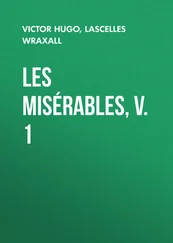Victor Hugo - Les Misérables / Die Elenden
Здесь есть возможность читать онлайн «Victor Hugo - Les Misérables / Die Elenden» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Les Misérables / Die Elenden
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les Misérables / Die Elenden: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Les Misérables / Die Elenden»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der ehemalige Sträfling Valjean vollzieht eine Wandlung zum Guten und nimmt sich des Waisenkinds Cosette an. Er wird aber immer wieder von seiner Vergangenheit eingeholt. Cosette verliebt sich in den jungen Anwalt Marius, der ebenso wie Valjean in den Pariser Barrikadenschlachten von 1832 für mehr soziale Gerechtigkeit kämpft. Durch Güte und Menschlichkeit überwindet Valjean alle äußeren und inneren Widerstände und stirbt am Ende versöhnt mit sich und der Welt.
#lestmalbittemehrbuch
Les Misérables / Die Elenden — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Les Misérables / Die Elenden», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Er hatte noch an Geschwistern, außer seiner Schwester, zwei Brüder, von denen der Eine General, der Andere Präfekt war und mit denen er einen ziemlich lebhaften Briefwechsel unterhielt. Mit dem Ersteren nun brach er auf einige Zeit alle Beziehungen ab, weil der General nach der Landung Napoleons in Cannes sich an der Spitze von zwölfhundert Mann aufgemacht hatte, den Kaiser zu verfolgen, aber mit der Absicht ihn entwischen zu lassen. Mit dem andern Bruder, dem ehemaligen Präfekten, der zu Paris in Zurückgezogenheit lebte, blieb er in besserem Einvernehmen.
Unser Bischof hatte folglich auch eine Zeit, wo er in das politische Parteigetriebe verwickelt war und infolge dessen auch manche trübe Stunde. Auch auf seinen Pfad warfen die wild erregten Leidenschaften seiner Zeit ihren Schatten und störten ihn in seiner Betrachtung der ewigen Dinge. Gewiß hätte es ein solcher Mann verdient, daß ihm zu seinen vielen Vorzügen auch der zu Theil geworden wäre, keine politischen Meinungen zu haben. Man mißverstehe uns nicht: Wir verwechseln keineswegs was man politische Meinungen nennt, mit jenen begeisterten Fortschrittsbestrebungen, jenem idealen Glauben an das Vaterland, die Demokratie und die Menschheit, auf dem alle hochsinnig veranlagten Naturen unserer Zeit fußen. Ohne Fragen erörtern zu wollen, die zu dem Thema unseres Buches in keiner direkten Beziehung stehen, behaupten wir nur, es wäre schön gewesen, hätte unser Bischof nicht royalistische Politik getrieben und seinen Blick keinen Augenblick von jenen hehren Regionen ruhevoller Betrachtung abgewendet, wo hoch erhaben über dem stürmischen Wirrwarr der menschlichen Dinge, in reinem Glanze, die Wahrheit Gerechtigkeit und Liebe strahlen.
Wir geben ja zu, daß Gott den Bischof Bienvenu nicht für eine politische Laufbahn bestimmt hatte, hätten es aber begriffen und bewundert, wenn er im Namen des Rechtes und der Freiheit, als Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht stand, sich zu freimüthigem Tadel und mannhaftem Widerstand erkühnt hätte. Aber dasselbe Verfahren, das einem Mächtigen gegenüber berechtigt ist, mißfällt uns, wenn es gegen eine gefallene Größe eingeschlagen wird. Wir billigen nur die Auflehnung, so lange sie mit Gefahr verbunden ist, und in allen Fällen steht nur Denen, die zu Anfang lauten Einspruch erhoben und sich zum Kampf ermannt haben, das Recht zu, nachher das Richteramt zu übernehmen und das Urtheil zu vollstrecken, den Feind zu vernichten. Wir persönlich glauben, daß von der Zeit an, wo die Vorsehung sich gegen Napoleon erklärte, jede Opposition gegen ihn aufhören mußte. Schon Angesichts des Unterganges der Großen Armee im Jahre 1812 fühlen wir uns ihm gegenüber entwaffnet. Daß 1813 der gesetzgebende Körper, kühn gemacht durch diese Katastrophe, sein langjähriges feiges Stillschweigen brach, kann nur unseren Unwillen erregen und dieses Verhalten zu billigen, war ungeziemend. 1814, als die Marschalle ihren Kaiser verriethen, als der Senat sich in Erbärmlichkeiten nicht genug thun konnte, als er von der Vergötterung zur Beschimpfung überging, als die Götzendiener, von feiger Angst befallen, ihren Götzen anspieen, war es Pflicht, Abscheu zu bezeigen. 1815, als die Endkatastrophe schon in der Luft schwebte, als ganz Frankreich wie von einem Vorgefühl des Verhängnisses ergriffen war, als man schon Waterloo und Napoleons Sturz in den Abgrund ahnen konnte, da hatte die Begeisterung des Heeres und des Volkes für den vom Schicksal aufgegebenen Kaiser Nichts, was eine Veranlassung zu lachen bot, und bei allem Vorbehalt gegen den Despotismus, hätte das edle Gemüth des Bischofs von Digne vielleicht nicht verkennen sollen, was der Bund einer großen Nation und eines großen Mannes Angesichts des Abgrunds Erhabenes und Rührendes hat.
Abgesehen hiervon war er und benahm er sich in allen Dingen gerecht, wahr, billig, weise, bescheiden und würdevoll; wohlthätig und wohlwollend, was ja übrigens nur eine andere Form der Wohlthätigkeit ist. Er war ein rechter Priester, ein Philosoph und ein Mann. Selbst als Politiker war er – so sehr wir seine Haltung Napoleon gegenüber mißbilligen – duldsam und nachsichtig, vielleicht mehr als wir, die wir dieses mittheilen. – Der Kastellan des Rathhauses verdankte seine Anstellung dem Kaiser. Der Mann war ein alter Gardeunteroffizier, der sich das Kreuz der Ehrenlegion bei Austerlitz verdient hatte und ein verbissener Bonapartist. Dem armen Kerl entschlüpften hier und da unbedachte Aeußerungen, die das damalige Gesetz als aufrührerische Reden qualifizirte. Seitdem die Abzeichen der Ehrenlegion nicht mehr das Bildniß seines Kaisers trugen, zeigte er sich nie in Uniform, um nicht den Orden auch anlegen zu müssen. Er hatte selber mit aller Ehrerbietung das Bildniß aus dem Kreuz, das ihm Napoleon gegeben, herausgenommen und nie die drei Lilien an seine Stelle setzen wollen. »Eher sterben«, schwur er, »als die drei Kröten auf meinem Herzen tragen.« Er machte sich auch ganz laut über Ludwig XVIII. lustig. »Wenn doch der alte Podagrist sammt seinen englischen Gamaschen und seinem Zopf nach Preußen gehen möchte!« ulkte er, indem er in seine Verwünschung des Bourbonen das, was er am meisten auf der Welt haßte, Preußen und England hereinzog. Er trieb es so arg, daß er seine Stelle verlor und nun mit Weib und Kind dem größten Elend ausgesetzt war. Da ließ der Bischof ihn zu sich kommen, schalt ihn milde aus und stellte ihn als Thürhüter am Dom an.
In neun Jahren war unser Bischof dank seiner frommen Mildthätigkeit und seinem sanftmüthigen Wesen in der Stadt Digne ein Gegenstand inniger, kindlicher Verehrung geworden. Sogar sein Verhalten gegen Napoleon verzieh das gute schwache Volk, das seinen Kaiser vergötterte, aber andererseits auch seinen Bischof liebte.
XII. Warum der Bischoff allein stand
Ein Bischof ist fast immer von einem Schwarm junger Geistlicher umdrängt, wie ein General von jungen Offizieren. Hat doch jedes Fach seine Streber, die sich um die am Ziel Angelangten schaaren. Kein Mächtiger, der nicht sein Gefolge; kein Glücklicher, der nicht seinen Hof hätte. Alle, die sich eine glänzende Zukunft schaffen wollen, gravitieren um eine glänzende Gegenwart. Jeder einigermaßen einflußreiche Bischof hat in seiner Nähe einen Trupp Seminaristen, die um ihn patrouilliren und darüber wachen, daß die Huld Sr. Gnaden keinen Andern, als ihnen zu Theil werde. Einem Bischof gefallen, verleiht die Anwartschaft auf das Unterdiakonat. Man will emporkommen; und eine fette Pfründe ist eine schöne Sache.
Wie unter den Beamten des Staates, so giebt es auch unter denen der Kirche, unter den Bischöfen solche, die über einen größeren Einfluß zu verfügen haben, als ihre Kollegen, diese Herren sind reich, gewandt, bei Hofe und in der höhern Gesellschaft gern gesehen, verstehen wohl zu Gott zu beten, aber auch die Großen dieser Welt zu bitten, die Vertretern ganzer Diöcesen nicht gern etwas abschlagen. Solche Bischöfe sind gewissermaßen Bindestriche zwischen der Kirche und der Diplomatie, mehr Welt- als Kirchenfürsten. Wohl Denen, die in ihrer Nähe weilen dürfen! Einflußreich wie sie sind, lassen sie auf ihre Günstlinge, auf all die jungen Priester, die sich bei ihnen einzuschmeicheln verstehen, einträgliche Pfarreien, Archidiakonate, Almosenämter und andere üppige Stellen und Stipendien niederregnen und ebnen für sie den Anfang des Pfades, der zur Bischofswürde führt. Indem sie selber vorrücken, fördern sie auch ihre Trabanten, wie eine Sonne mit ihren Planeten durch das Weltall vorwärts, immer vorwärts wandert. Das Licht, das sie von sich strahlen, beleuchtet ihr Gefolge im Verhältnis zu seiner Stärke: Je großer die Diöcese des Gebieters, desto einträglicher fällt die Pfarre des bevorzugten Dieners aus. Und nun erst Rom! Nimmt dich ein Bischof, der so gescheidt ist, sich zum Erzbischofsthron emporzuschwingen, oder ein Erzbischof, der es bis zum Kardinal gebracht, nach Rom als Conclavisten mit, so wird man in die Rota gewählt und bekommt das Pallium, wird Kammerherr und heißt »Monsignore«. Wer erst Se. Bischöfliche Gnaden heißt, steigt bald zur »Eminenz« empor, und zwischen Sr. Eminenz und Sr. Heiligkeit liegt auch nur eine Abstimmung. Kurz, jedes Priesterkäppchen kann gegen die Tiara eingetauscht werden. Der Priester ist heutzutage der Einzige, der regelrecht König werden kann, und was für ein König! Der oberste von allen Königen. Welch eine Pflanzschule von Hoffnungen ist daher auch ein Priesterseminar! Wieviel schüchterne Chorknaben, wieviel junge Abbés tragen auf ihrem Kopfe den berühmten Topf Milch des Märchens, den sie allmählich in Gedanken gegen immer theurere Waaren eintauschen! Wie leicht giebt sich der Ehrgeiz, – oft indem er in seliger Selbstbetrachtung sich zuerst täuscht – für edle Begeisterung aus!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Les Misérables / Die Elenden»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Les Misérables / Die Elenden» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Les Misérables / Die Elenden» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.