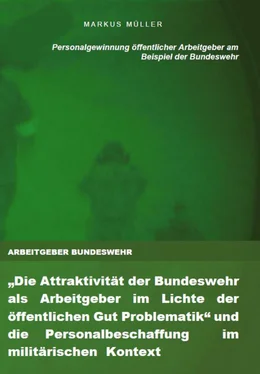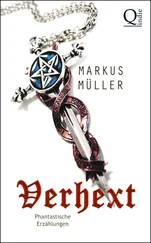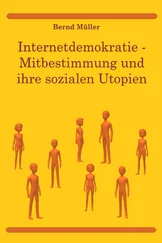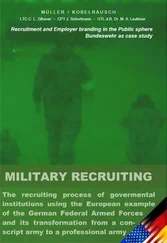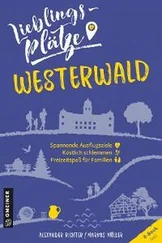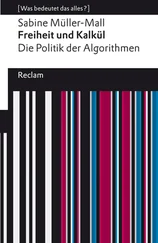Neben dieser Veränderung der sozialgesellschaftlichen Bedeutung der Bundeswehr für Deutschland folgte zum 1. Juli 2011 durch die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht ein weiterer tiefgreifender Wandel für die deutschen Streitkräfte. So sieht sich nunmehr auch die Bundeswehr den Schwierigkeiten vieler anderer Berufsarmeen bei der Gewinnung und Rekrutierung der erforderlichen Zahl neuer Rekruten ausgesetzt. Daher muss die Bundeswehr zukünftig einen Bezug zur Gesellschaft über andere Bereiche und über die frühere Wehrpflicht hinaus herstellen.
Die Bundeswehr muss ein attraktiver Arbeitgeber sein und einen Transformationsprozess von ihrer Wahrnehmung als Streitmacht, hin zu einem „besonderen Arbeitgeber“ auf dem Arbeitsmarkt vollziehen.
Von diesem Ansatz ausgehend, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit in Verbindung mit einer eigenen quantitativen Primärdatenstudie, mit der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber im Lichte der öffentlichen Gut Problematik und dem Personalrecruiting im militärischen Kontext. Insbesondere der einsetzende demografischen Wandel 6, die sukzessive Verrentung geburtenstarker und der Berufseintritt geburtenschwacher Jahrgänge sind dabei zu berücksichtigen. Ergänzt wird dies noch durch die neuen Herausforderungen an die deutschen Streitkräfte. Durch den Wegfall der Wehrpflicht befindet sich die Bundeswehr nun vollständig mit zivilen Unternehmen im Wettbewerb um die klügsten Köpfe und die richtigen Mitarbeiter. Damit kommt dieser Fragestellung eine ganz besondere Gewichtung von nachhaltiger Bedeutung und Wirkung zu. Zudem rückt die Bundeswehr in ihrer Nach-Wehrpflicht-Ära immer weiter in ein wissenschaftliches Forschungsinteresse für den Bereich der Personalgewinnung, zu dem es für den Arbeitgeber BW in Deutschland lediglich bis dato sehr spärliche wissenschaftliche Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen an Politik und Streitkräfte gibt.
An diesem Punkt will die nachfolgende Studie aufsetzen und soll neben einer Anwendung bestehender Forschungsansätze auf den „Arbeitgeber Bundeswehr“ auch eine erste wissenschaftliche Grundlagenthematisierung zur Personalgewinnung deutscher Streitkräfte sein, wie es sie bereits für viele andere Armeen gibt, die sich seit längerem intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen mussten.
2. Die öffentliche Gut-Problematik
2.1 Die Bundeswehr und das öffentliche Gut „Sicherheit“
Nach Art. 87a des Grundgesetzes werden „Aufstellung und Einsatz der Streitkräfte“ der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Die BW hat damit den Schutz des Landes und somit die „äußere Sicherheit“ des deutschen Hoheitsgebietes zur Aufgabe. Im direkten Wortlaut heißt es im GG Artikel 87a:
(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.
(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.
(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.
Hierdurch wird das Gut „Sicherheit“ für Deutschland als „innere“ und „äußere Sicherheit“ definiert und der Auftrag deutscher Streitkräfte klar festgelegt. Der Kernauftrag der Bundeswehr ist dabei die Wahrung und ggf. Wiederherstellung der äußeren Sicherheit. Der Schutz der inneren Sicherheit obliegt hingegen der Polizei und der Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz). Nur in einem ganz eng abgesteckten Rahmen ist dabei der Einsatz der Streitkräfte im Inneren überhaupt möglich (vgl. hierzu auch GG Art. 35 mit Rechts- und Amtshilfe, sowie der Katastrophenhilfe). Unter Verwendung des ersten Satzes: Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. (Art. 87a, Satz 1) ergibt sich, dass die Bundesrepublik nicht nur Streitkräfte aufstellen kann, sondern dies auch zu ihrer Verteidigung tun muss. Impliziert gilt daher, dass dieses auch in ausreichender Form, Stärke und Ausrüstung zu geschehen hat. Durch deren Einbindung in den Haushaltsplan und die Definition parlamentarischer Kontrolle ergibt sich zudem ein „Primat der Politik“ 7über die Armee, die keinen Staat im Staat bilden darf, sondern ein Querschnitt der Gesellschaft sein soll. Bezugnehmend auf die Generierung der notwendigen personellen Stärke an Soldaten der Bundeswehr in Verbindung mit der Wehrpflichtaussetzung in 2011 ergibt sich daraus abgeleitet die Forschungsfrage „Welches sind die besten Methoden der Bundeswehr für eine aktive Personalgewinnung“ dieser Arbeit. Daher wird nachfolgend nicht nur die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber untersucht, sondern vorab auch die Problematik öffentlicher Güter thematisiert, da eine Armee keinen Selbstzweck erfüllt sondern als Aufgabe die staatlich legitimierte Bereitstellung des öffentlichen Gutes „äußere Sicherheit“ hat, die sich aus dem staatlichen Gewaltmonopol 8ergibt.
2.2 Definition und Problematik öffentlicher Güter und Ressourcen
2.2.1 Definition
Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei herausstechende Eigenschaften aus. Ihre Klassifizierung ist daher über die Konsummöglichkeit bzgl. der Merkmale Rivalität und Ausschließbarkeit möglich (Samuelson, 1954). Ein öffentliches Gut weist dabei A) Nicht-Ausschließbarkeit des und B) Nicht-Rivalität im
Konsum(s) auf. Ein „reines öffentliches Gut“ verfügt über beide dieser Merkmalsausprägungen. Liegt nur eines dieser Merkmale vor, handelt es sich bei diesem öffentlichen Gut um ein „unreines öffentliches Gut“. Besteht beispielsweise nur Nicht-Ausschließbarkeit vom, aber Rivalität im Konsum 9, so handelt es sich um „Allmendegüter“. Liegt hingegen Nicht-Rivalität im, aber Ausschließbarkeit vom Konsum vor, handelt es sich um „Clubgüter“. Diese werden in der Literatur jedoch oft auch als „Mautgüter“ oder als ein „natürliches Monopol“ bezeichnet. Herrscht hingegen keine dieser beiden Merkmalsausprägungen vor, so handelt es sich um ein „privates Gut“, dass sich sowohl durch Rivalität im als auch durch Ausschließbarkeit vom Konsum auszeichnet. Ein elementarer Bestandteil für die Ausschließbarkeitsbedingung ist dabei das Vorliegen wohldefinierter Eigentumsrechte. Erst aufgrund durchsetzbarer Eigentums- und Verfügungsrechte können andere Individuen vom freien und unentgeltlichen „Free Rider“ Zugang zu einem Gut ausgeschlossen werden. Für ein privates Gut ist dies vollständig der Fall. Für ein Clubgut ist der Zugang hingegen an die Zahlung von z.B. einer Maut oder eines Eintrittspreises (diese sind zumeist jedoch nicht kostendeckend für die Bereitstellung des unreinen öffentlichen Gutes) gebunden.
Читать дальше