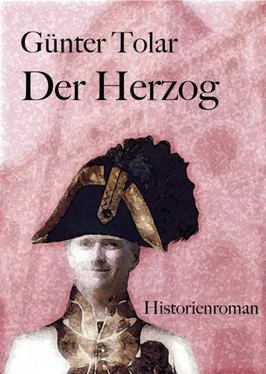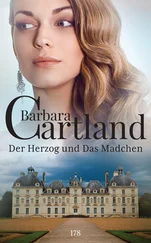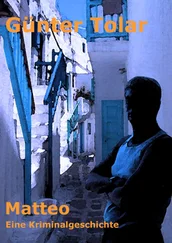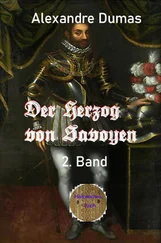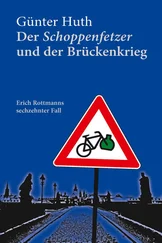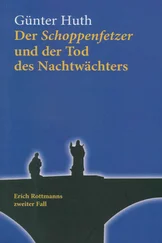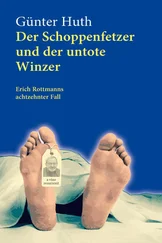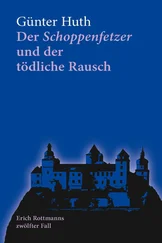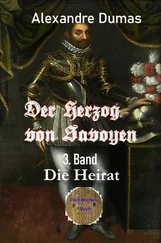Günter Tolar - Der Herzog
Здесь есть возможность читать онлайн «Günter Tolar - Der Herzog» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Herzog
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Herzog: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Herzog»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Herzog — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Herzog», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Mein Herr Sohn lassen also den Schneider nicht kommen, sondern bemühen sich selber zum Schneider.“
Das schrie mein Herr Vater ganz ohne vorherige Ankündigung.
„Welch eine Herablassung: Kann er mir die vielleicht erklären?“
Ich war so sprachlos, daß ich sicherlich nicht fähig war, sogleich zu antworten. Das war aber auch gar nicht notwendig, denn mein Herr Vater schrie sogleich weiter: „Oder muß ich das wieder von der geheimen Polizei erfahren? Vielleicht erkundig’ ich mich überhaupt gleich beim Sedlnitzky, was in meiner Familie so alles vorgeht, ha?“
Erst jetzt verstummte mein Herr Vater. Er setzte sich brüsk in seinen Lehnstuhl und sah mich so herausfordernd an, daß ich wußte, jetzt war es an der Zeit, mir eine gute Antwort auszudenken.
Aber immer ging’s mir im Kopf herum, der Sedlnitzky. Wie vor einer Woche beim Schneider-Hans: der Sedlnitzky kümmert sich um uns, um mich; um den Sohn des Erziehers Napoleon des II. Na freilich, wir waren hochnotpeinliche Personen.
Joseph Graf Sedlnitzky war zu Anfang des Jahres ‚Präsident der Obersten Polizei- und Zensurbehörde’ geworden. Er hat, wohl ganz im Sinne Metternichs, den ‚Polizeistaat’ zu höchster Perfektion geführt. Das Spitzelsystem war nahezu lückenlos. Die Wiener nannten das Heer der ‚nebenberuflichen’ Spitzel ‚Naderer’. Damals wie auch später war es eine der Charaktereigenschaften des Wieners, über den anderen etwas zu wissen und aus diesem Wissen Kapital zu schlagen zu versuchen. Dieses Kapital war bis dato lediglich in Triumphe, Schadenfreude und heimliches Händereiben umsetzbar. Seit Sedlnitzky aber wurde bar bezahlt. Zudem schaffte der geheime Graf es auch, alle Druck-Erzeugnisse und Briefe fast lückenlos von seiner Zensur erfassen zu lassen.
Es war also nur zu klar, dass der Erzieher von Napoleons Sohn und dessen Familie strengstens observiert wurden. Völlig folgerichtig hatte der Joseph Moritz jetzt also Angst, Vater Dietrichstein war verärgert und im Hause Dietrichstein somit Krach angesagt.
„Darf ich also von ihm erfahren, was ihn dazu treibt, den Schneider aufzusuchen wie eine hergelaufene Straßenkundschaft?“
Mein Vater hat mit mir geschrien, seine an sich starke und eher sonore Stimme drohte fast überzuschnappen.
Ich kam aber gar nicht zum Antworten, da schrie er schon weiter: „Ich darf doch annehmen, daß mein Herr Sohn weiß, daß sein Vater eine Vertrauensstellung hat und somit ein Vertrauen genießt, das ihm sowohl Seine Kaiserliche Majestät als auch seine Durchlaucht der Staatskanzler entgegenbringen. Oder vielmehr entgegengebracht haben. Denn jetzt gilt es ja zu klären, was mein Herr Sohn beim Schneider zu suchen hat, anstatt ihn, wie es immer war, kommen zu lassen.“
Ich schickte mich jetzt zu gar keiner Antwort an; mich beschlich nämlich der Verdacht, daß mein Herr Vater nur erpicht darauf war, mir einen Vortrag zu halten. Vielleicht hatte er sogar Angst; und versuchte sich dieser Angst nun klar zu werden, indem er sie, wenn auch schreiend, so doch, formulierte.
„Ist ihm das klar?“, schrie mich der Vater plötzlich an.
„Ja“, antwortete ich schnell. „ich darf anfügen, daß es mir auch nie unklar gewesen ist.“
Plötzlich war er beruhigt: „Dann ist es ja gut. Darum möchte ich aber auch in aller Zukunft gebeten haben.“
Er wollte den Salon, in dem sich die Szene abgespielt hatte, eben verlassen, da drehte er sich unter der Türe noch einmal um und warnte mich mit wackelndem Zeigefinger: „Übrigens, der Rüschchen- und Bändchenschnickschnack hört jetzt auf. Das einzig Französische in unserer Familie ist Seine Kaiserliche Hoheit. Der macht mir wenigstens Freude.“
Den speziellen Anlass zur Freude hat uns Graf Dietrichstein nicht hinterlassen. ‚Kaiserliche Hoheit’ war gerade sechs Jahre alt, die Beziehung, der Joseph Moritz’ Tagebuch später fast ausschließlich gewidmet ist, hat noch nicht begonnen, wenn sich auch Voraus - Spuren jetzt schon finden. Es ist allerdings hinterher immer verführerisch, in Kenntnis des Endes rückschauend so manches zur Spur zu erklären, was möglicherweise noch gar keine war. Jedenfalls sind die paar Notizen im Tagebuch, die zum Thema ‚Napoleons Sohn’ aufzufinden waren noch in keiner Weise Hinweise, wenn man sie auch später doch als solche identifizieren könnte. Aber hier offenbart sich die Zweifelhaftigkeit historisch hergestellter Zusammenhänge, die ja immer rückschauend und somit viel gescheiter sind, als es die, die es erlebt haben, jemals sein hatten können. Rückschauend weiß man dann immer das, was man, zur besseren Bewältigung der Situation, besser vorher gewusst hätte. Aber in der Kluft zwischen Hinterher-Besser-Wissen und Vorher-Nicht-Gewußt-Haben, aber vielleicht Vorher-Wissen-Hätte-Sollen liegt wohl das, was man Geschichtsschreibung nennt.
Aber zitieren wir doch die vermeintlichen Spuren. Da findet sich inmitten einer belanglosen Alltagsschilderung über ein Missgeschick, das eine Köchin des Hauses mit einem Kuchen gehabt hatte, ein den Tag abschließender Hinweis.
Vater lobte den Mehlspeisenkoch seines Zöglings über die Maßen, was Mama in gelinde Scham trieb, da sie wahrscheinlich annahm, daß Vater das nur deshalb tat, um die blamable Sache mit der Mehlspeis’ in unserer Küche, vielmehr in der von meiner Mutter geleiteten Küche, nur ja nicht gleich wieder auf sich beruhen zu lassen.
„Aber wir werden ja selbst Gelegenheit haben, das bald zu kosten“, kündigte er an.
„Warum denn?“ und „Wann denn?“, waren die Fragen, die wir ihm jetzt stellten.
„Heute in einer Woche, ja, genau heute in einer Woche.“
Dieser exakte Hinweis des Vaters erlaubt uns, das Datum der Notiz ganz genau festzulegen, es ist der 13. März 1817.
„Heute in einer Woche hat seine Kaiserliche Hoheit seinen sechsten Geburtstag. Und ich habe die Ehre, meine Familie mitbringen zu dürfen.“
„Zur Feier?“, fragten alle ungläubig; wir wußten doch, daß diese Feier auf allerhöchster Ebene stattzufinden hatte, zumal ja eben doch eine Kaiserliche Hoheit Geburtstag feierte; das war eine Feier wie bei einem Erzherzog; und da waren wir auch nie geladen.
„Nein, nein“, lächelte Vater milde, „zur Feier erscheinen nur wir.“
„Wir?“, riefen alle wieder entzückt.
Vater setzt eine tadelnde Miene auf: „Ihr spielt eine schlechte Posse mit mir! Wir, das sind wir, seine Erzieher.“
„Aha“, ging es in der Runde.
Irgendjemand aber erlaubte sich doch zu fragen, ich glaube, es war Mutter: „Und wir?“
Leises Gekicher war die Folge, das jedoch von Vater mit einem Rundumblick beruhigt wurde.
„Zum Kaffee, am Nachmittag“, erlöste er endlich gnädig die Fragerunde.
„Der Kleine trinkt Kaffee?“, fragte Mutter erstaunt.
Wieder der tadelnde Erzieherblick des Vaters: „Seine Kaiserliche Hoheit lädt zum Kaffee. Die Familien seiner Erzieher. Er selbst wird vermutlich keinen Kaffee trinken.“
Vater dachte angestrengt nach und stellte dann nachdrücklich nickend fest: „Also das wäre mir doch aufgefallen. Nein, nein!“
Damit schien er beruhigt.
Mutter scheint sich auf den Tag zu freuen.
Ich fühle mich in Gegenwart seiner Kaiserlichen Hoheit nicht wohl. Zumal ich es einfach zu drollig finde, daß wir Großen vor diesem Buben die großen Complements machen müssen und er das auch noch huldvoll entgegennimmt. Der Kleine weiß genau, was ihm zusteht, das macht ihn unsympathisch und uns klein. Immerhin gut, daß niemand sieht, wenn wir Standspersonen, die wir von anderen selber Respekt einfordern, plötzlich Kotaus vor einem Kind machen müssen.
Wieder einmal der Hinweis auf den Stand, in dem sich Joseph Moritz sehr stark fühlt. Und wieder das Angerührt-Sein, wenn er gezwungen ist, sich vor anderen, in diesem Fall Höheren, zu beugen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Herzog»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Herzog» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Herzog» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.