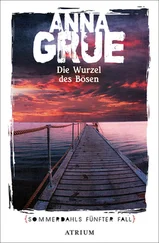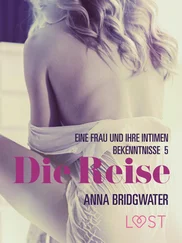Doch in all dem Chaos stach dieser eine Gedanke immer deutlicher hervor. Ein Gedanke, für den ich Jahre zu alt war. Ein Gedanke, der mich mit solcher Furcht erfüllte, dass ich den Atem anhielt. Ein Gedanke, der alles erklären könnte. Wenn ich ihn nur ließe …
„Endlich begreift Ihr.“ Die knarzige Stimme ließ mich vor Schreck zusammenzucken.
„Wer – “ Suchend sah ich mich um, doch da war niemand.
„Wenn Ihr erlaubt, mich vorzustellen?“
Die Stimme kam vom … „Heilige – “ Die nächsten Worte blieben mir im Hals stecken. Auf dem Tisch gegenüber saß ein Frosch. Ein kleiner, grüner Frosch.
„Sir Henry Irvin Edgar Wallace“, stellte er sich galant vor, „Aber für Euch, Mylady, nur Wallace.“
Er deutete eine Verbeugung an. „Ich bin höchst erfreut, endlich Eure Bekanntschaft machen zu dürfen.“
Ich war kurz davor, einen Herzinfarkt zu erleiden. „Wie zur Hölle –“
Ruhig bleiben … Ich schloss die Augen und zählte.
Eins. Ich musste verrückt geworden sein.
Zwei. Sprechende Frösche existierten nicht.
Drei. Ich öffnete die Augen und der Frosch grinste zu mir herauf.
„Ihr könnt die Augen so oft schließen wie Ihr wollt, Mylady, aber davon werde ich nicht verschwinden.“
Ich schnappte nach Luft. Das war vollkommen unmöglich. Das widersprach allem, einfach allem!
Und doch passte es so perfekt in das absurde Puzzle der letzten Nacht …
„Ihr habt die richtigen Schlüsse gezogen, Mylady“, kommentierte der Frosch inzwischen, „Scheut Euch jetzt nur nicht, die Tatsachen zu akzeptieren, die diese Schlüsse mit sich bringen.“
Ich schüttelte den Kopf.
„Das ist nicht wahr“, sagte ich laut. Weder der Frosch noch diese absurden Gedanken verschwanden.
„Das ist nicht wahr“, wiederholte ich, „Das kann nicht wahr sein, nichts davon!“
„Wollt Ihr wirklich leugnen, dass ich hier sitze? Direkt vor Euch?“ Die riesigen Froschaugen funkelten provokant. „Ihr wisst doch genauso gut wie ich, was mit Euch passiert ist …“ Er machte eine kurze Pause, grinste. „… oder besser gesagt: Wo Ihr Euch gerade befindet?“
Fassungslos sah ich ihn an.
„Nein“, hauchte ich, „Nein, das ist nicht – Ich bin nicht …“
„Und ob Ihr hier seid, Mylady.“ Altklug spazierte der Frosch über den Tisch. „Ihr seid hier, mitten in Ciaora. Genauer gesagt neuneinhalb Meter unter dem moosigen Boden des Foraoise gan Deireadh, des unendlichen Waldes. Wobei Euch ja offensichtlich eher die Tatsache interessiert, wo Ihr nicht mehr seid – in Eurer Welt.“
„Ihr lügt!“ Der Schrei entrang sich meiner Kehle so selbstverständlich wie das Amen. „Ihr seid nicht mehr als eine Halluzination, eine Einbildung – noch dazu eine schlechte!“
„Also das ist nun wirklich unerhört!“ Der Frosch hatte die dürren Arme verschränkt und war wie erstarrt vor mir stehengeblieben. „Wie könnt Ihr es wagen, mich einen Lügner zu nennen? Oder eine Halluzination?“ Aufgeregt erhob er die Arme zum Himmel. „Ich weiß noch nicht einmal, was von beidem die größere Beleidigung ist.“
Er schnaubte. „Aber gut! Von mir aus! Wenn Ihr meine Hilfe nicht wollt, werde ich Euch nicht länger belästigen.“
Noch bevor seine letzten Worte bei mir angekommen waren, erschien wie aus dem Nichts ein eigenartiger lilafarbener Nebel, der immer dichter wurde, bis er den Frosch schließlich ganz umhüllte.
„Undankbares Pack!“, glaubte ich ihn noch murmeln zu hören, dann lichtete sich der Nebel und der Frosch war wie vom Erdboden verschluckt.
Völlig durcheinander sank ich auf die Pritsche.
Das konnte nicht sein! Das alles konnte nicht die Wahrheit sein! Und doch war es die einzig logische Erklärung für alles, was in der letzten Nacht passiert war – für die Hütte ohne Strom, für die Kleider, die Heilerin und diese Tunnel, für den sprechenden Frosch – und für dieses Wesen, diese Bestie.
Ich wischte mir die wirren Strähnen aus den Augen und erhob den Blick zur Decke des Raumes. So viel Stein. Und darüber eine andere Welt? War das die Antwort, nach der ich gesucht hatte?
Ich war erstaunt, dass ich den Gedanken tatsächlich zuließ. Die Vorstellung allein war absurd, doch irgendwie passte alles zusammen. Es war so einfach, wie nur die Realität sein konnte.
Eine andere Welt …
Doch Raymond hatte versprochen, mich zurück nach Calgary zu bringen. Die Erinnerung entzündete einen Funken in meinem Inneren, der nur Sekunden darauf in Zweifel entflammte. Denn ein klitzekleiner Teil tief in mir wusste, dass nichts, was der Frosch gesagt hatte, wahr sein konnte. Dass es weder Magie noch andere Welten gab.
Und dieser Teil von mir war wahnsinnig vor Angst, denn er konnte nicht erklären, warum dieses gelbäugige Monster existierte, warum Frösche sprachen und Großmütter mit Schwertern um sich schlugen.
Kapitel 5
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, als ich jemanden vor der Tür hörte. Morgen, war das Einzige, was mir einfiel, Es musste endlich Morgen sein. Ich stand auf und öffnete die Tür, bevor auch nur ein Klopfen zu hören war.
Raymond musterte mich überrascht. „Also das … ging wirklich schnell.“
Ich entgegnete nichts. Seit Stunden hatte ich an nichts anderes denken können als die Worte des Frosches. Sinn und Unsinn hatten mein Inneres durcheinandergewirbelt, bis ich nicht mehr wusste, was ich glauben sollte. Raymonds Anwesenheit ließ mich allerdings wieder Hoffnung schöpfen. Er hatte versprochen, mich nach Calgary zu bringen und dass er jetzt hier war, konnte nur eines bedeuten.
„Komm.” Er legte mir eine Hand auf die Schulter und begann, mich den Gang hinunterzuführen. „Hast du gut geschlafen?”
Ich zögerte, während mein Magen nervöse Purzelbäume schlug. „Nicht richtig.”
Wir bogen um eine Ecke und Raymond gab ein Brummen von sich. „Das habe ich mir schon gedacht.”
Eine Viertelstunde und unzählige Abzweigungen später erreichten wir einen Raum. Er war etwas größer als das Zimmer, in dem ich eingesperrt gewesen war, aber ebenso schlicht möbliert. Es gab einen großen Tisch mit einem Stuhl auf der einen und zwei weiteren auf der gegenüberliegenden Seite. Dazu einige als Regale dienende Bretter an der Wand. Überall lag Papier – Karten, Notizen und Briefe – gemischt mit Büchern, Lupen, Stiften und anderen Utensilien.
„Ich verstehe nicht.” Hilfesuchend wandte ich mich an Raymond. „Was machen wir hier?”
Anstelle einer Antwort ging er einmal um den Tisch herum.
„Setz dich“, sagte er und wies auf einen der beiden Stühle vor mir, „Möchtest du ein Glas Wasser?“
Eilig räumte er den Tisch frei und holte eine Kanne sowie zwei Becher von einem kleinen Beistelltisch. Noch immer stand ich wie festgenagelt in der Mitte des Raumes.
„Sie haben versprochen, mich nach Calgary zu bringen”, sagte ich und hörte mich dabei an, wie ein weinerliches Kind, dem sein Spielzeug weggenommen wurde. Wallace’ Worte schienen mit jeder Minute lauter durch meine Gedanken zu hallen. Angespannt ballte ich die Fäuste.
„Evangeline.” Raymond seufzte. „Wir sollten reden. Ich denke, es ist Zeit, dass ich dir einiges erkläre.”
Ich schnappte nach Luft. War es das? Eine düstere Ahnung legte sich wie eine Hand um meinen Hals und ließ mich nach Luft ringen. Meine Beine begannen zu zittern und ich schaffte es gerade noch, mich an der Lehne des Stuhls festzuklammern. Kraftlos sank ich auf die harte Sitzfläche. Ich spürte Raymonds besorgten Blick auf mir ruhen, während er ein Glas mit Wasser füllte und es vor mir abstellte. Mein Kopf war mit einem Mal wie leergefegt.
„Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, dass du so lange warten musstest.“ Raymonds Stimme war nahezu tonlos, als würde er die Worte eines Protokolls zitieren. „Die letzte Nacht muss sehr aufwühlend gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass du viele Fragen hast.”
Читать дальше