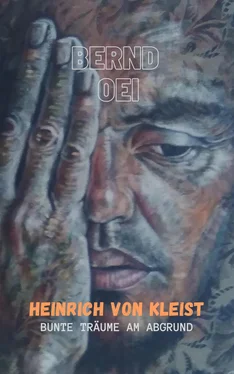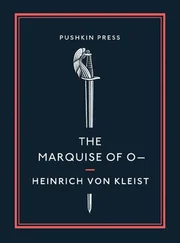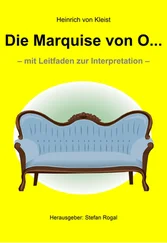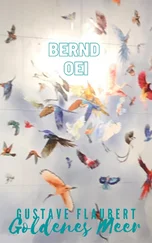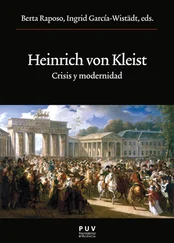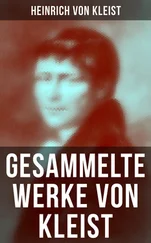1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Fichte hat sein Bild definitiv von Kants „Träume eines Geistersehers“, wo die Gläser das Verhältnis zwischen Diesseits und Jenseits verrücken. Auch Fichte hat wohl ein Teleskop vor Augen, was den Bezug zu Gott aufrechterhält. Von Kleist deutet es als Glasaugen um. Selbst wenn es sich um ein Missverständnis handelt und nicht um dichterische Freiheit, so bleibt die Verschiebung von Erkenntnis elementar. Für von Kleist ist die moralische Seite der Wahrheit von der epistemologischen getrennt.
Auch Tieck, mit dem von Kleist später in Dresden zusammentrifft, benutzt das Gläser-Gleichnis in seiner Komödie „Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack“ (1799), indem er den Stallmeister die Worte in den Mund legt, „ Als ich letzthin die Optik studirte, bemerkt' ich, daß es etliche unterschiedliche Farben gäbe, als roth, blau, grün und so weiter“. Der Verweis auf Fichte findet durch den Protagonisten gleichen Vornamens Gottlieb Betonung . Der Stallmeister will die neue Wissenschaft studieren, um sich nochmals „ von vorne erziehen zu lassen. “ Diese Wendung variiert von Kleist in Variation für seinen Essay „Über das Marionettentheater“.
Das Motiv, von vorne beginnen zu müssen, taucht auch in Lessings „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ (1780) auf, das von Kleist vertraut ist und in engem Zusammenhang mit „Nathan der Weise“ steht. Da Gott „ einem jeden einzeln Menschen sich nicht mehr offenbaren konnte, noch wollte: so wählte er sich ein einzelnes Volk zu seiner besonderen Erziehung; und eben das ungeschliffenste, das verwildertste, um mit ihm ganz von vorne anfangen zu können.“ 45
Summa summarum repräsentiert die Analogie der bunten Gläser einen Verweis auf die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen, aus denen eine Einheit geformt werden kann und muss. Die substantielle Einheit liegt dabei im Ich. Der Zweck der Verschiedenheit liegt in der Meinungsbildung, dem Austausch von Möglichkeiten und der schrittweisen Annäherung an die nicht sichtbare Wahrheit dahinter. Wahrheit und Bildung streben jedoch auseinander und eine systemische Einheit bzw. Synopse gerät zunehmend ins Wanken. Mit Fichte intensiviert sich die Bedeutung von Meinungs-und Gewissensfreiheit.
II. 3. 2. Doppelgänger - Motiv und Ich-Spaltung
Bereits „Die Bestimmung des Menschen“ (Dezember 1800) ist im Kunstgespräch-Dialog gehalten, der u. a. den Essay „Über das Marionettentheater“ auszeichnet. Cassirer, der sich vornehmlich auf dieses Werk für seine Theorie der Kantkrise stützt, bezieht lediglich die ersten beiden Teile Zweifel und Wissen ein. Dass mit 1801 ein Wendepunkt hinsichtlich der Emanzipation Fichtes von Kant einsetzt und sich auch von Kleist mehr der Subjektphilosophie anschließt, die dem Wollen und der Tat mehr Bedeutung schenkt, ist naheliegend. Kants Kritik der praktischen Vernunft wird zum Drehpunkt seiner und Fichtes Reflexion, da sie die Grundlage für das Miteinander und dem Aufbau der Gesellschaft bilden. Fichte nimmt Anstoß an dem Ding an sich, bei dem Kant stehen bleibe als unhintergehbar und sucht im Ich das Subjekt als höchste Instanz zu etablieren; nur was Ich ist auch Ding an sich , da dieses ein reines Konstrukt der Vorstellung bzw. der Einbildungskraft ist und vom Ich gesetzt wird.
Fichtes Anspruch besteht darin, Kant zu vollenden; es ist sein erstes Werk nach dessen Tod und arbeitet direkt seiner „Wissenschaftslehre“ zu, die zur Jahrhundertwende die populärste im gesamten deutschsprachigen Gebiet wird. Die Metapher vom rollenden Rad der Geschichte in seiner dynamischen Entwicklung und einer Welt, die auch ohne Gottes Segen auskommt, ist nachhaltig für von Kleist. Ebenso die Vorlesungen, die er 1806 in Berlin hält und die von Kleist mit seinem Vorgesetzen Freiherr vom Stein zu Altenstein und Chamisso besucht, so dass ihm der Satz „ES kann kein böser Geist sein, der an der Spitze der Welt steht“ aus den Vaterländischen Vorlesungen bereits vor der schriftlichen Publikation bekannt ist. Gerade der nationale Charakter und Patriotismus Fichtes, die in „Reden an die deutsche Nation“ 1808 kulminiert und die Rhetorik lösen Enthusiasmus in von Kleist aus.
Der Begriff Lebensplan stamm gleichfalls von Fichte, wenngleich in folgender Formulierung nicht substantiviert: „ Die erste Handlung der Selbsttätigkeit eines Menschen lautet: Es kommt darauf an, dass ein mündiger Mensch einen Plan für sein Leben entwirft. Einen solchen Plan habe ich längst entworfen .“ 46In seiner anschließenden Rede „Über die Würde des Menschen“ lässt er verlautbaren: „ Der Mensch wird Ordnung in das Gewühl und einen Plan in die allgemeine Zerstörung hineinbringen; durch ihn wird die Verwesung bilden und der Tod zu einem neuen herrlichen Leben rufen.“ Diese Zeilen könnten aus der Feder von Kleists stammen, aber zu dieser Zeit fühlt er sich noch nicht zum Dichter berufen. Zu diesem Zeitpunkt aber verlässt er die Armee und nimmt sein Studium auf. Er ist zwanzig Jahre, bildungshungrig, sein Geist formbar.
Durchaus vorstellbar, dass „Die Bestimmung des Menschen“ nach der er selbst forscht, seinen Nerv wie den der meisten jungen Leute seiner Zeit trifft. Allerdings könnte die Fichte-Lektüre auch zeitversetzt und damit nach der Kant-Krise eingesetzt haben. Von zentraler Bedeutung ist die, in der Bestimmung durch den Dialog auch formal erfüllte, Identitätsproblematik und Zweiteilung des Menschen. Bereits Kant verweist darauf, dass jeder Gut und Böse in seiner Seele und nie ein Absolutes davon in sich trägt, weshalb er auf eine höhere metaphysische Instanz (Gott) rechnet, die dem Tugendhaften in seinem moralischen Gesetz beisteht. Ein literarisches Exempel für die Dopplung des Ich liefert die Erzählung „Michael Kohlhaas“ durch die Rolle der Zigeunerin, deren Identität nicht geklärt wird, deren Dokument dem Todgeweihten unversehens Macht gewährt und die als zweites Ich seiner gerade verstorbenen Frau erscheint.
Entscheidend ist Fichtes Prioritätsverschiebung von Wissen auf Handeln, von Gesinnungs-auf Erfolgsethik, die einen, dem Idealismus meist abgesprochenen, Pragmatismus inkludiert.
Februar 1801 schreibt von Kleist: „ Ich meine darum, weil man beständig und immer von neuem handeln soll und doch nicht weiß, was recht ist. Wissen kann unmöglich das Höchste sein – handeln ist besser als wissen. Aber ein Talent bildet sich im Stillen, doch ein Charakter nur in dem Strome der Welt. Zwei ganz verschiedene Ziele sind es, zu denen zwei ganz verschiedene Wege führen. Kann man sie beide nicht vereinigen, welches soll man wählen? Das höchste, oder das, wozu uns unsre Natur treibt? – Aber auch selbst dann, wenn bloß Wahrheit mein Ziel wäre, – ach, es ist so traurig, weiter nichts, als gelehrt zu sein .“ 47Höhepunkt der Krise, die ihn in die Schweiz treibt ist der folgende Brief an seine Schwester: „ Der Gedanke, daß wir hienieden von der Wahrheit nichts, gar nichts, wissen, daß das, was wir hier Wahrheit nennen, nach dem Tode ganz anders heißt, und daß folglich das Bestreben, sich ein Eigentum zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ganz vergeblich und fruchtlos ist, dieser Gedanke hat mich in dem Heiligtum meiner Seele erschüttert – Mein einziges und höchstes Ziel ist gesunken, ich habe keines mehr.“
Der Zweifel „Du“ ist der Dialogpartner und Wegbegleiter des „Ich“. Liest man Fichtes Inszenierung eines philosophischen Dramas, so könnte darin die Ursache seiner Verzweiflung liegen, über deren Gründe von Kleist nichts sagt. „ Welche Macht kann mich von dir, welche Macht kann mich von mir selbst retten? 48„ Du wolltest wissen von deinem Wissen; du suchtest das Wissen da, wohin kein Wissen reicht, und hattest dich schon überredet, etwas einzusehen, das gegen das innere Wesen aller Einsicht streitet.“ Von Kleist ist folglich überzeugt, dass man sich nur selbst erziehen kann, weil nichts ins Ich hineingezwängt zu werden vermag, was nicht hinein will. Das Individuum bleibt in radikal vereinsamender Weise zurückgeworfen auf sich selbst. Es muss, um aus dieser Isolation herauszufinden, aus seinem Selbst einen Doppelgänger erzeugen.
Читать дальше