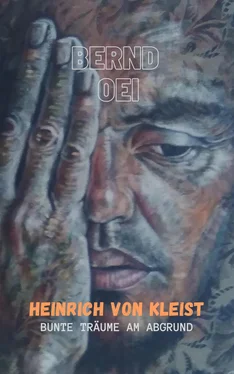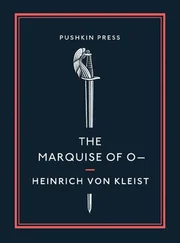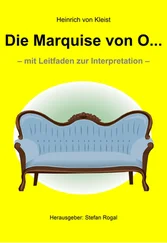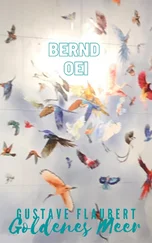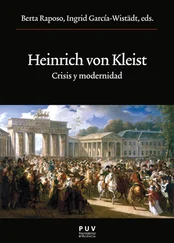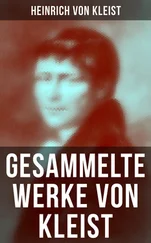1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Kant nennt Moral in seiner „Kritik der Vernunft“ ein intellektuelles Gefühl und versteht darunter unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit, die gleichzeitig bereits eine subtile Interpretation, ergo ein Urteil, inkludiert. Ästhetik und Ethik sind folglich gar nicht zu trennen, insofern zählt der Gebrauch des Verstandes, die Qualität und nicht die Summe von Erkenntnis oder Wissen.
Wäre der Mensch ein reines Verstandeswesen, er müsste mechanisch handeln und bedürfte der Empfindung nicht. Er ist aber ein Zusammengesetztes (Synthesis a priori), der immer situativ und kontextual eingebunden handelt. Jedes Urteil teilt ihn in zwei Sphären und nichts vermag diese Zerrissenheit aufzulösen, soweit der Mensch ein fühlendes Wesen ist. Von Kleist sucht einen „Schwerpunkt“ der Marionette, der außerhalb des Menschen liegt.
Kant verweist auf den fragmentarischen und zugleich doppelbödigen Charakter der Sprache selbst. Von Kleist knüpft an: „ Wie gern möchte ich dir alles mitteilen, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich, und wenn es auch kein weiteres Hindernis gäbe als dieses, daß es uns an einem Mittel zur Mitteilung fehlt. Selbst das, einzige, das wir besitzen, die Sprache, taugt nicht dazu, sie kann die Seele nicht malen, und was sie uns gibt, sind nur zerrissene Bruchstücke.“ 40
II. 3. 1. Die grünen Gläser
Die Zahl der Studien über von Kleists Fichtelektüre ist wesentlich überschaubarer als die zu Kant oder Rousseau. Eine Nahtstelle, zumal der Name nirgendwo auftaucht, aber die neue Kantianische Philosophie auf ihn verweist, zudem ab 1806 eine persönliche Bekanntschaft vorliegt und er in Berlin die aufgenommenen Vorlesungen Fichtes gehört haben muss, da er Interna vor der schriftlichen Veröffentlichung kennt. Einer der Vertreter der These, dass es sich gar nicht um eine Kant-sondern eine Fichtekrise gehandelt hat ist Ernst Cassirer, dessen Hauptargument darin besteht, dass Fichte in „Die Bestimmung des Menschen“, das Januar 1815 publiziert wird, als neue Kantianische Philosophie bezeichnet und erstmals eigene Wege geht, obgleich Kant sich noch zu Lebzeiten von Fichtes Auslegung distanziert. Fichte selbst gibt jedoch vor, sein System nur mit anderer Rhetorik zu vertreten und der Erfolg gibt ihm Recht: die Popularität des Königsbergers setzt erst mit Fichte und der Frühromantik ein. Novalis, Hölderlin und von Kleist sind um die Jahrhundertwende an der Tat und Fragen der praktischen Vernunft sowie der Ästhetik (Urteilskraft) stärker interessiert als an der reinen Vernunft, die beim Ding an sich „ stehen bleibt “ (Fichte)
Grüne Gläser, die Augen ersetzen, spielen bei von Kleistkeine Rolle, die Farbe, ist primär Vorstellung ein Spezifikum Fichtes. Grüne Brillengläser werden zur Schonung der Augen empfohlen, u. a. von Goethe, der als Kulturminister für Fichtes Karriere verantwortlich zeichnet und ihm während des Atheismusstreites die anfängliche Unterstützung entzieht, das Heine in „Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland“ rügt, da am Gottesvertrauen Fichtes ebenso wie Kants keine Zweifel bestehen können. Inhaltlich kommt Fichtes Wissenschaftslehre, die er aus „Die Bestimmung des Menschen“ entwickelt, von Kleist näher bzw. seinem Naturell entgegen. In der 1799 publizierten und von Kleist zumindest in groben Zügen bekannten, wahrscheinlich aber komplett durchgearbeiteten „Verantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus“ lautet der Passus: „ Was wir erblicken, ist immer das erste [spontanes Handeln]; das Instrument, gleichsam das gefärbte Glas, durch welches hindurch wir unter gewissen Bedingungen es allein erblicken können, ist die Einbildungskraft; und in diesem gefärbten Glase verändert es seine Gestalt, und wird zum zweiten [zum ausgedehnten Stoff ].“ 41
Bezüglich Fichtes Gleichnis Fichte rekurriert von Kleist nicht auf komplexe optische Apparaturen, sondern auf Alltagserfahrungen, zumal er seine Worte in seinem Bildungsanspruch an die Verlobte richtet: „ Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urtheilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün — und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzuthut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört.“
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kamen grüne, gelegentlich auch blaue Brillen zum Schutz gegen direktes Sonnenlicht auf. Farbige Gläser wurden auch gegen wissenschaftliche Einwände auch um die Jahrhundertwende verkauft 42. Eine religiöse Protestbewegung, die Apparate nur aus ökonomischen Interesse zu veräußern, existierte, so dass katholische Prediger grüne Brillen als Metapher für Unmoral oder für Unverbindlichkeit der Aufklärung verwendeten. Künstler betrachteten die Gläser als Symbol für den falschen Schein. Während der Französischen Revolution wurden die Brillen als unnatürlich stigmatisiert und als Bekenntnis zum Ancien Régime gewertet. Die Frühromantik knüpfte daran an, erst während der Wiener Restauration erfreuten sie sich wieder der Beliebtheit: Gläser wurden von Hoffmann mehrfach symbolisch für den Übergang in eine andere Welt verwendet.
Er überträgt die Stimmung des Grotesken und Unheimlichen vom funkelnden Grün der Brillen auf grün funkelnde Augen. Nachdem die Brillen selbst seltener geworden sind, bedarf es ihrer nicht mehr, um die mit ihnen verbundenen Angstgefühle zu aktivieren, oder das Motiv droht gar unverständlich zu werden.
Im April 1799 immatrikuliert sich von Kleist an der Philosophischen Fakultät der Universität Frankfurt Oder. Der Skandal um Meinungs-und Gewissensfreiheit, der mit Fichtes Demission endete, ist brandaktuell. Fichtes Bild vom farbigen Glas steht im Zusammenhang des Nachweises, dass Gott eine stoff-zeit- und raumlose, intelligible Größe ist, folglich unterschiedlich vorgestellt werden kann.
Alles Denken beruht auf eine Konstruktion des Ich, Gott wird zum Produkt der Einbildungskraft (nicht der Fantasie). Dabei konfigurieren sich zwei Arten von Schemata: Handeln und ausgedehnten Stoff. Handeln inkludiert den ersten, ursprünglichen Grund für eine Ereignisreihe; es erfolgt spontan außerhalb der Reihe von Ursachen und Folgen und ist übersinnlich, sprich intelligibel. Fichte heißt es intellektuelle Anschauung, um sie gegen Kants sinnliche Anschauung, Zeit und Raum, abzugrenzen. Alle Materie bleibt als ausgedehnter Stoff sinnlich innerhalb der Kausalreihe.
Das spontane Handeln, bei Kant noch spontanes Vermögen der Vernunft, erweist sich als Alleinstellungsmerkmal des Menschen, das moralische Handeln und alle Erkenntnisprinzipen initiiert. Sinnliches Vorstellungsvermögen und Einbildungskraft sind für Fichte ein und dasselbe .Sämtliche Anschauung der Objektwelt (Materie) basiert auf ursprünglich spontanen Denkakte. Wir sind immer auch das, was uns als Gegenstand gegenübersteht; das Ich ist das Ding an sich selbst. Handeln muss zunächst Gegenstände wahrnehmen und sinnliches Vorstellungsvermögen durchlaufen, um zum höheren, spontanen Denken zu gelangen. Bei diesem Durchgang wird es gemäß der sinnlichen Anschauung räumlich und zeitlich modifiziert und erscheint daher als Gegenstände.
Es sind auch andere Quellen für die Gläser denkbar, vor allem Klingers 43anspruchsvoller Roman „Der Kettenträger“ (1796), der darin Positionen Kants, Fichtes und Rousseaus zu vermitteln sucht. Der relevante Passus lautet: „ Vielleicht weil jeder glaubt, er habe den größten Splitter der Wahrheit in seinem Systeme; sein Glas, wodurch er, zum Beispiel, alle Gegenstände grün sieht, sey das untrügliche“ .
Auch Brentano verwendet für seinen Roman „Godwi“ ein Glas-Gleichnis: „ Das Romantische ist also ein Perspectiv oder vielmehr die Farbe des Glases und die Bestimmung des Gegenstandes durch die Form des Glases ." 44Gestalt gilt Brentano als Grenze des Gedachten, das Ungestaltete ist das Unbegrenzte. Da der Roman bereits 1798 gestaltet wird und von Kleist den Fichteaner Brentano kennt (ihre Freundschaft endet im Disput über die Berliner Abendblätter) ist anzunehmen, dass er die Wendung vor der Veröffentlichung des zweibändigen Briefromans kennt. „ Das grüne Glas ist das Medium der Sonne .“
Читать дальше