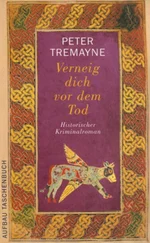„Die unangenehmen Zeiten habe ich vergessen“, behauptete sie immer, aber ich glaube, sie wollte einfach nicht darüber sprechen.
Stattdessen schwärmte sie von dem Zusammenhalt der Familie und den feucht-fröhlichen Familienfeiern in den Fünfzigern, die auch auf vielen Fotos festgehalten sind.
Diesmal dauerte ihr Krankenhausaufenthalt zehn Tage, dann konnte ich sie wieder aus dem Krankenhaus abholen und nach Hause bringen. Doch im Gegensatz zu dem letzten Mal setzte sie sich etwas ratlos in ihrer Wohnung auf den Sessel, diesmal keine große Freude und auch keine Zukunftspläne. Irgendwie schien sie selber nicht damit gerechnet zu haben, wieder gesund zu werden, und der Lebensmut war ihr offenbar abhandengekommen.
Das konnte nicht lange gut gehen, und es dauerte nur eine Woche, dann ging alles wieder von vorne los: Anruf vom Krankenhaus am frühen Morgen, dass Tante Sophie schon wieder mit akuten Herzproblemen eingeliefert worden ist, diesmal jedoch auf der Intensivstation lag.
Der Besuch in der Intensivstation war für mich am allerschlimmsten. Wie oft habe ich Mario nach seiner Geburt in der Intensivstation besucht, jedes Mal voller Angst, wie es ihm geht, und ob er überhaupt noch am Leben ist. Ich wusste genau wie das abläuft: Erst voller Sorge vor der Station klingeln, nach einer kleinen Ewigkeit kommt eine Schwester und zeigt den Raum, wo man sich die sterilen Kittel anziehen kann. Schon allein dieser fürchterliche stechende Geruch der Sterilisationsmittel und das schrille Klingeln der Alarmtöne erinnerten mich an zurückliegende, schreckliche Zeiten, die ich eigentlich vergessen wollte, und trieben mir die Tränen in die Augen. Jetzt wieder, wie gewohnt, zusammenreißen, keine Schwäche zeigen, schlucken, kräftig durchatmen und sich allein auf die Patientin konzentrieren.
Als ich das Zimmer betrat, lag sie in dem Bett am Fenster und schlief friedlich.
Doch sie musste gehört haben, dass jemand gekommen war, denn sie öffnete die Augen.
„Dass du wieder gekommen bist!! Liebe, liebe Julia!“, flüsterte sie dankbar. „Du bist immer da, wenn man dich braucht“.
Ich hielt ihre Hand und sie döste noch ein wenig, bis der Arzt kam und sie untersuchte. Er machte mir noch einmal klar, wie schwach Tante Sophies Herz war, wollte sie aber trotzdem im Laufe des Tages auf die Normalstation verlegen lassen, was dann auch geschah. Jedoch diesmal fühlte ich, dass sie aufgegeben hatte und der ganze Lebensmut von ihr gegangen war. Sie schien sich den Tod jetzt förmlich zu wünschen und sehnte sich als gläubige Christin sogar nach einem weniger beschwerlichen Leben nach dem Tod.
Trotz allem sah es eine Zeitlang so aus, als würde sie sich abermals erholen. Ganz langsam ging es wieder bergauf, und ich hoffte schon, sie zum dritten Mal in Folge halbwegs genesen aus dem Krankenhaus abholen zu können.
Es war ein Schock für mich, als ich sie am Samstagmorgen besuchte, und sich ihr Gesundheitszustand plötzlich über Nacht dramatisch verschlechtert hatte.
Trotzdem erkannte sie mich und freute sich sichtbar über mein Kommen, eine Unterhaltung wurde aber schwieriger. Wir hörten stattdessen gemeinsam geistliche Chormusik von meinem CD-Player, und ich hielt dabei ihre Hand. Als das Vaterunser gesungen wurde, faltete sie die Hände betend zusammen und richtete ihren Blick anbetend nach oben. Ich bewunderte sie für ihren tief empfundenen Glauben und hoffte, dass sie dafür belohnt wurde. Das sollte die letzte Erinnerung für mich an Tante Sophie werden.
Der folgende Tag entwickelte sich als einer der schrecklichsten meines Lebens.
Wie gewohnt ging ich am nächsten Morgen die langen Krankenhausgänge entlang, grüßte die netten Krankenschwestern, die ich inzwischen schon kannte, klopfte kurz an Tante Sophies Zimmertür, trat aber, da ihr die Antwort inzwischen schon schwer geworden war, ohne abzuwarten ein.
„Guten Morgen“, grüßte ich und ging zu ihrem Bett.
Fassungslos blickte ich kurz darauf auf Tante Sophie: Noch niemals zuvor hatte ich einen toten Menschen gesehen, doch in diesem Augenblick war mir sofort klar, dass sie verstorben war. Die Hautfarbe war gelblich und sah ein wenig aus als wäre sie aus Wachs. Panikartig verließ ich den Raum und holte eine Krankenschwester.
Ein kurzer Blick ihrerseits genügte, und sie bestätigte meinen ungeheuerlichen Verdacht.
„Vor einer halben Stunde haben wir sie noch gewaschen und ihr Bett gerichtet“, sagte sie. „Dass es so schnell geht, hätten wir nicht gedacht. Ich hole den Chefarzt Dr. Pohl, damit er den Totenschein erstellen kann. Sie können sich inzwischen noch einmal in Ruhe von ihr verabschieden.“
Daraufhin verließ sie das Zimmer, und ich war wieder allein mit Tante Sophie.
Mir liefen die Tränen über die Wange, als ich zu ihrem Bett ging und ihr sanft über die Wange strich: „Jetzt hast du es geschafft.“, flüsterte ich. „Du hast es dir ja so sehr gewünscht… Ich hoffe, es wird jetzt alles so, wie du es dir ersehnt hast.“
In diesem Augenblick trat schon Dr. Pohl ein, und ich hatte keine Zeit mehr, weiter zu trauern. In vielen Jahren habe ich gelernt mit solch schweren Situationen umzugehen. Ich lasse dann keine Gefühle mehr an mich heran und reagiere wie fremdgesteuert. Wenn dieser Zustand wieder vergeht und kein akuter Handlungsbedarf mehr erforderlich ist, breche ich meistens zusammen, und es geht mir dann dafür besonders schlecht.
Ganz sachlich sprach ich also mit dem Arzt der Palliativstation, der Tante Sophie schon so viele Jahre lang behandelt hatte. Vor Wochen hatte ich ihn ja bereits bei einer Visite bei Tante Sophie im Krankenhaus kennengelernt.
„Ihr Lebenswille war erschöpft“, stellte er fest und ich stimmte ihm zu. „Ich gebe zu, dass es sicherlich ein Grenzfall war. Als Chefarzt der Palliativstation bin ich definitiv gegen die aktive Sterbehilfe, da es viele andere Möglichkeiten gibt, der Natur ihren Lauf zu lassen und den Betroffenen medikamentös Schmerzen und Ängste zu nehmen. Seit Freitag haben wir ihre Medikamente, speziell ihre Herzmedikamente, abgesetzt, um ihren Wunsch nach einem Übergang in ein höheres Leben zu erfüllen und uns nicht durch die Einnahme lebensverlängernde Arzneien dagegen zu stemmen.“
„Wieso hat er das nicht vorher mit mir abgesprochen?“, schoss es mir sogleich durch den Kopf. „Ich habe doch die Patienten- und Betreuungsverfügung, was ihm auch durchaus bewusst ist. Trotzdem hat er alles hinter meinem Rücken alleine entschieden.“
Dennoch war ich dermaßen mit der Situation überfordert, dass mir die Kraft fehlte, mich mit ihm jetzt und hier zu streiten, zumal ich nicht sicher behaupten konnte, dass es eine Fehlentscheidung war.
Es klopfte, Schwester Kristina betrat das Zimmer und unterbrach damit eine weitere Diskussion.
„Wir haben jetzt die unangenehme Aufgabe, alle Wertgegenstände der Verstorbenen zu erfassen und in Briefumschlägen zu versiegeln“, erklärte sie mir. „Das wird eine Weile dauern. Wir packen auch ihren Koffer, und Sie können dann alles zusammen in etwa einer Stunde abholen. Es besteht auch die Möglichkeit für Freunde und Angehörige, sich anschließend noch einmal von ihr zu verabschieden. Bitte benachrichtigen sie die, wenn es Ihnen möglich ist.“
Ich nahm daraufhin Tante Sophies Adressbuch vom Nachttisch, wobei mein Blick auf einen handgeschriebenen Zettel auf ihrem Rollator fiel. Es handelte sich unverwechselbar um die zackige Handschrift von Pastor Stark, die ich schon oft gesehen hatte.
„Im Fall des Todes sofort Pastor i.R. Adolf Stark benachrichtigen!!!“, stand dort in dem für ihn üblichen Kommandoton.
Die Krankenschwester war meinem Blick gefolgt und fragte: „Möchten Sie Herrn Stark benachrichtigen oder sollen wir das tun?“
Bei Tante Sophies Geburtstagsfeier hatte ich diesen Menschen als arrogant und überheblich empfunden. Deshalb verspürte ich in dieser schwierigen Situation auch nicht den geringsten Wunsch mit ihm zu sprechen oder gar seine Weisungen entgegenzunehmen. Ich wollte einfach nur in Tante Sophies Sinne entscheiden, wie ich es fühlte und für richtig empfand, und mir nicht von einem Fremden reinreden lassen. Also bat ich die Krankenschwester, Herrn Stark zu informieren.
Читать дальше