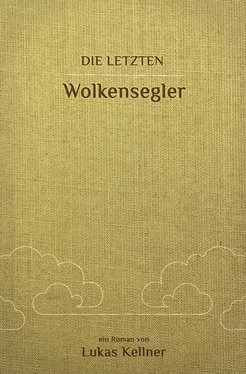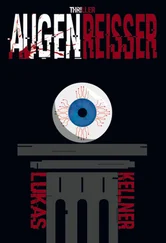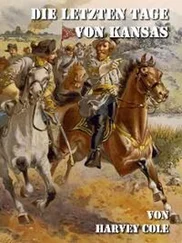1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 „Dabei sollst du deine Augen mit Sonnenlicht bedecken“, hieß es in mehreren Kommentaren, die sich lasen wie Bibeltexte – von den Rechtschreibfehlern darin einmal abgesehen – und dazu führten, dass Anhänger der Ideologie ihre Augenpartien mit gelber Farbe schminkten. Zu Beginn belächelt von Regierung und Behörden, entwickelte sich die Bewegung mehr und mehr zu einer Bedrohung. Je aussichtsloser die Situation, je länger die Unwissenheit darüber, was das Massensterben verursachte, je widersprüchlicher die Aussagen der Politiker und Wissenschaftler, desto mehr Gehör fanden die Botschaften der Suicidals. Chen erinnerte sich an einen Kommentar unter den Postings dieser Selbstmörder, der ihm aufgefallen war, kurz nachdem die Regierung den Mindestabstand auf einen Meter erhöht hatte: „Ich glaube nicht an euren Bullshit! Aber die Drecks-Politiker haben keine Ahnung. Und wenn ich den Rest meines Lebens allein sein muss, dann bin ich halt lieber tot.“
Als die nächste Sterbewelle die Menschheit auf fünf Milliarden reduzierte, wurden Regierungsvertreter aller Welt aus den Städten evakuiert. Der Präsident der Vereinigten Staaten war bereits tot, genauso wie die Staatsoberhäupter von Frankreich, Großbritannien, Schweden, Mexiko und Polen. Den Menschen wurde jetzt empfohlen, zueinander stets drei Meter Abstand zu halten, was in den Städten so gut wie unmöglich war. Es war der Tag, an dem es wirklich schlimm wurde. Stadtbewohner gerieten in Panik und verließen fluchtartig die urbanen Regionen des Landes. Jeder fürchtete sich vor seinem Nächsten. Der Tod war Mensch geworden, denn jeder Mensch konnte Tod bedeuten. Das führte dazu, dass alle nur noch auf sich bedacht waren, das Ende der Rücksicht, der Nächstenliebe, der Zivilisation. Die Gesellschaft war aufgehoben. Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Bruder, Schwester, Kollege und Kollegin, all das gab es nicht mehr. Binnen weniger Tage hatte die Krankheit die Fundamente der Menschheit zerbröckelt, so mühelos und selbstverständlich, als hätte es nie einen Zusammenhalt zwischen Individuen gegeben. Hinzu kamen die Suicidals. Ihre Angriffe wurden immer häufiger. Dabei rannten sie auf flüchtende Menschen zu, umarmten sie und starben mit ihnen. Die Krise hatte sie zum Ding werden lassen, nicht zum Menschen und auch nicht zum Tier, denn kein Tier tut, was sie getan haben, leblos, seelenlos, hoffnungslos.
Die Städte waren jetzt leer. Der Mensch zurück, einen Schritt näher an der Natur, doch noch nicht zur Gänze aus der Zivilisation vertrieben. Die überlebenden Regierungen etablierten ein neues Krisenmanagement. Sie schafften es, essentielle Versorgung aufrecht zu erhalten. Dies war auch der Tatsache geschuldet, dass die existierenden Notfallpläne mittlerweile auf die gesamte Menschheit ausgelegt waren. Auf über sieben Milliarden Menschen, von denen jetzt nur noch vier Milliarden übrig waren.
In den kommenden Wochen trauerte die Erde. Zwar verschlimmerte sich die Lage nicht, doch war sie ohnehin schrecklich genug gewesen. Die Menschen konnten sich nur noch auf zweieinhalb bis drei Meter nähern. Der soziale Kontakt war damit stark eingeschränkt, in einer Zeit, in der sich jeder nach einer Schulter zum Anlehnen verzehrte. Die Trauer war groß. Jeder hatte Tote zu beklagen. Verwandte, Geliebte, Kinder.
Über einen Monat lang versuchten sich die Menschen in Zusammenhalt zu üben. Der Gedanke, der in vielen Wurzeln schlug, gab ihnen Hoffnung: So viel mussten wir leiden, so viel Schmerz und Tod. Von jetzt an wird es besser werden!
Auch Chen war dieser Meinung gewesen und führte seine Arbeit fort. Er war ebenfalls auf das Land geflohen, in das Haus seiner Großeltern. Er erinnerte sich daran, wie ihre Leichen aussahen. Sie hatten sich das Leben genommen, mit einem erfüllten Leben hinter- und der Hölle vor sich. Gestorben, Arm in Arm.
Chen legte im gedimmten Licht seiner Petroleumlampe den letzten Zeitungsartikel weg und sah dann ihr Bild. Er hatte es vorsorglich mit den anderen Erinnerungen weggesperrt. Seit Jahren mied er dieses Foto. Denn ihre Augen verbrannten sein Innerstes und trafen ihn wie einer der Pfeile im Köcher, der neben ihm an der Holzwand lehnte.
Er stellte den leeren Eintopf zur Seite und sah nach draußen. Finsterste Nacht war eingekehrt. Kein Mond, der sein silbernes Licht an die Rinden warf, oder Sterne, deren Glitzern durch die Kronen blitzte und die so vom Bild in seinen Händen hätten ablenken können. Da war nur sie. Mit lautem Lachen und glücklichem Blick. Seine Schwester.
Sie hatte dunkelbraune Haare gehabt, fast schwarz, ähnlich dem geölten Holz des Nussbaums. Ihre Haut, ihre Augen, ihre Wangen und sogar das eine Grübchen auf der rechten Seite kamen von ihrer Mutter. Während Chen eher seinem Vater glich, blass und mit schwarzem Haar, hatte seine Schwester braungebrannte Haut, häufig kombiniert mit einem verschmitzten, frechen Lächeln, das einen herausforderte, nur um im nächsten Moment zu sagen, dass es ja doch alles Spaß war. Ihre blauen Augen strahlten hell wie Leuchtsteine, sogar nachts noch, wenn eigentlich gar kein Licht da war, das hätte reflektiert werden können. Anders als Chen war sie schon als Abenteurerin geboren worden, mit breiter Brust und erhobenem Kinn, mit einem natürlichen, gesunden Selbstbewusstsein, das es ihr ermöglichte, großherzig zu sein und zu vergeben, aber eben auch ‚nein!‘ zu schreien, ‚halt!‘ und ‚stopp!‘ auszurufen, wenn manches nicht richtig lief. Das führte dazu, dass sie sich nur selten etwas gefallen ließ. Als sie Kinder waren, hatte sie Chen einmal verprügelt, weil er ihr die Fernbedienung des Fernsehers entrissen hatte, vollkommen zurecht, wie er sich erinnerte, denn sie durfte an diesem Tag eigentlich das Programm bestimmen. Dabei war es ihr egal, mit wem sie es zu tun hatte und wie groß oder stark derjenige war: Wenn es sein musste, legte sie sich mit jedem an. Seine Schwester war trotz allem der mitfühlendste und sensibelste Mensch, dem er in seinem gesamten Leben begegnet war. Wie keine andere fühlte sie, wenn ihm etwas auf dem Herzen lag und er es einfach nicht aussprechen wollte, weil er sich davor fürchtete oder sich schämte oder beides. Und sie war witzig. Seine Schwester konnte der witzigste Mensch der Welt sein, zumindest, wenn sie Zeit mit ihm verbrachte. Dann erfand sie Sprüche, Pointen und eigene Kalauer als hätte sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan und als sei ihr Geist eine nie versiegende Quelle der Kreativität. So war sie. Seine Schwester. Aya.
Er verlor nach der Flucht in das Haus seiner Großeltern den Kontakt zu Aya. Das Mobilfunknetz funktionierte nicht mehr zuverlässig und es gelang ihm nicht, sie zu erreichen. Bei seinem Vater hatte er mehr Glück. Auch er überlebte die ersten Wellen des Sterbens und drängte darauf, sich bei seiner alten Jagdhütte zu treffen. Weit weg von allen wollte er mit seinem Sohn überdauern, bis es vorbei war. Doch Chen widersetzte sich, obwohl ihm das eigentlich überhaupt nicht ähnlichsah. Zeit seines Lebens hatte er sich in Demut geübt, war hörig geblieben im Angesicht des weisen Alters. Die Welt hatte ihm diesen Respekt diktiert, aber wenn die Welt nicht mehr existierte, dann zum Teufel damit. Er fühlte, dass es noch nicht vorbei war und dass er nicht einfach tatenlos dasitzen wollte. Er versuchte, Kontakt mit den anderen Überlebenden der Shima Shinbun aufzunehmen, ging mit vollem Eifer an die Arbeit, denn ein Ziel war Sinn und Sinn fehlte an allen Ecken und Enden. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Neben den Schwierigkeiten, die dem Notstand geschuldet waren – nur sporadisch Strom, Internet und Mobilfunk – stellte sich ihm die Sterblichkeit in den Weg. Gerade einmal zwei der ihm bekannten Mitarbeiter der Zeitung hatten überlebt. Er wusste noch genau, wie es war, als er Dominique erreichte, einen ehemaligen Jungredakteur, mit dem er bis dato nur zwei Mal an der Kaffeezeile geplauscht hatte.
Читать дальше