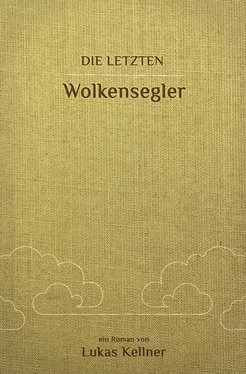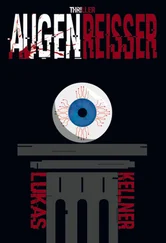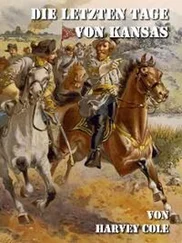Die letzten
Wolkensegler
ein Roman von
Lukas Kellner
Originalausgabe August 2021
© Lukas Kellner, 2021
Covergestaltung: Lukas & Daniela Kellner
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Verlag: Waiter Serves Productions - Lukas Kellner
Stossberg 4, 87490 Haldenwang
www.ws-productions.de, info@ws-productions.deKorrektorat: Karina Klüg Druck: epubli - ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Eins – Chen
Chen erwachte, sah in den Spiegel und fühlte sich schlecht. Er sah auch schlecht aus. Langsam fuhr er sich über die müden Augen und vermochte nicht viel in seinem „Spiegel“ zu erkennen. Ein Außenstehender hätte der Scherbe vor ihm wohl die Bezeichnung „Spiegel“ verwehrt, ihn denunziert oder wenigstens in der Namensgebung auf seine Unvollkommenheit hingewiesen. Doch Chen nannte das Stück Glas genau so, einen Spiegel, denn das fühlte sich besser für ihn an. Normaler.
Von den braunen Wänden flackerte das Licht der Petroleumlampe und tanzte um die Schatten herum, die sich hinter Chens Rücken formierten. Draußen war es noch dunkel. Die Sonne würde sich innerhalb der nächsten Stunden über dem Wald erheben, doch bis dahin lag das Geäst weiterhin in triefender Schwärze da. Chen betrachtete sich kritisch und konzentriert, stellte bald fest, dass er es geschafft hatte, sein Gewicht zu halten. Trotzdem fielen feine Schatten über seine Wangen und waren Zeuge von der Mangelernährung, die ihm vor allem in den letzten Wochen schwer zu schaffen machte.
Seine Augen waren grün und erinnerten ein bisschen an die Farbe eines Prachtkäfers. Stand das Sonnenlicht richtig, erstrahlten sie voll des Stolzes, trat Chen hingegen in den Schatten hinein, so sogen sie auch die Dunkelheit in sich auf und verloren ihr schönes Funkeln. Sein Haar war schwarz, dünn, fast schon seidig. Früher hatten sie ihn darum beneidet, die anderen Männer. Selbst ohne Haarwachs konnte er seine Frisur drapieren, wie es ihm gerade gefiel, sie blieb immer in Form und Gestalt, genau so, wie er es eben haben wollte. Dabei wäre es ihm lieber gewesen, er hätte mehr von der Körpergröße der anderen gehabt. Mit seinen 1,75 Metern war er einer der Kleinsten gewesen, in einer Welt, in der Größe zählte. Und einen Bart. Den hätte er gerne gehabt, doch wuchs der bei ihm nur fleckig-flaumig, so dass er zum Vollbart niemals taugen würde. Er hatte sich damit abgefunden. Es ging vielen Asiaten so. Es ging vielen Männern so. Dafür hatte er ja seine Haare.
Er nahm den kleinen Kanister und füllte Wasser in die weiße Schale vor ihm. Nachdem er sich gewaschen und von der Trägheit der Nacht befreit hatte, stellte er die Schüssel zurück auf den Boden, setzte sich auf den dreibeinigen Hocker davor und zog sich die Socken von den Füßen. Es sah grausig aus. Zwei neue Blasen waren hinzugekommen und dort wo die alten verschwunden waren, lagen jetzt tiefe, nässende Krater aus Fleisch und Blut. Vorsichtig tunkte er mit den Zehen in die Schale. Seine Finger vergruben sich in seinen Oberschenkeln, als der Schmerz von den Füßen hinauf in die Hüfte strahlte und sich darin verbiss. Er hatte keine Binden mehr, aber noch trieb ihn der Hunger nicht in das nächste Dorf, also würde er sich vorerst mit einem selbstgemachten Wickel aus Spitzwegerich und anderen Heilkräutern versorgen müssen. Er behandelte die betroffenen Stellen vorsichtig mit den grünen, entzündungshemmenden Blättern, die er bereits tags zuvor gesammelt hatte und zog sich die Socken wieder an. Während er sich die Klamotten überstreifte, bemerkte er den Duft von Ammoniak, der sich faulig-brackig in der Hütte ausbreitete. Er würde T-Shirt, Hose und Pullover waschen müssen. Die letzten Tage waren anstrengend gewesen und der Stoff hatte schon lange kein Wasser mehr gesehen.
Der Anblick seiner Füße, gepaart mit dem schwer zu ertragenden Geruch, den er nicht mehr aus seiner Nase bekam, führte ihm vor Augen, was an diesem Tag alles auf dem Spiel stand. Heute musste er erfolgreich sein oder er würde wieder an Gewicht verlieren. Er nahm den Sportbogen und legte sich den Köcher mit den Pfeilen um. Danach griff er zu dem braunen Unterarmschutz, der an einem Haken neben seinem Spiegel hing und wickelte ihn sich an die empfindliche Stelle oberhalb der linken Hand, dort wo blanke Haut vom scharfen Schnitt der Sehne beschützt werden musste. Das Messer. Die Feldflasche. Dann hinaus.
Die Vögel waren wie immer die ersten und fieberten dem Tag in voller Lautstärke entgegen. Chen ging den gewohnten Weg und hüpfte dabei immer wieder über die vielen, kleinen Bäche, die seinen Wald durchzogen. Ein magischer Wald. Das war er damals schon und das war er geblieben. Das Holz, die Blätter, Pilze und Moose hatte es nicht gekümmert, kein bisschen hatte sie das Sterben interessiert. Vielleicht lag es daran, dass dieser Ort bereits früher nur sehr wenig Menschen kannte, denn er war schwer erreichbar, durch Täler und Schluchten hindurch; Straßen und Parkplätze fehlten, waren fremd und unnötig, weil es ohnehin keine fahrenden Autos mehr gab. Zur nächsten Kleinstadt brauchte es einen Fußmarsch von drei Tagen, doch mied jetzt jeder die Städte.
Normalerweise redete Chen mit sich selbst, wenn er im Wald unterwegs war. Dann erzählte er sich von seinem Tag und tat manchmal überrascht, so als hätte er gar nicht ahnen können was ihm, Chen, bisher passiert war. Er war sich selbst der beste Zuhörer geworden und lauschte unentwegt seinen eigenen Erzählungen. Wieder sprang er über ein kleines Bächlein. Es war der Yukon. Er hatte diesem kleinen Wasser einen Namen gegeben, so wie er es mit allen Wasserzungen tat, die den Wald durchzogen. Als ihm keine berühmten Flussnamen mehr eingefallen waren, hatte er ihnen einfach Menschennamen gegeben. Gerade überquerte er Ashoka. Sie war die Schönste von allen, denn ihr Ufer war gleichmäßig bemoost und ihr Grund klar, wie bei einem erhabenen Gebirgsbach, bei dem einem vor Kälte die Zähne wehtaten, wenn man daraus trank.
Die Vögel wurden jetzt lauter und seine Umgebung immer heller. Es war das unausweichliche Schicksal der Nacht, jeden Tag aufs Neue: gleich würde sie sich geschlagen geben und ihren Niedergang hatte man bereits seit Stunden kommen sehen. Hätten sie es damals auch kommen sehen müssen? Hätte er es kommen sehen müssen? Sein Vater hatte ihm damals am Telefon davon erzählt, als es anfing. Von einem kleinen Clan, der noch nach den Traditionen der alten Welt lebte, Bartmäer nannten sie sich. Sein Vater hatte Kontakt mit einem Mann der Bartmäer namens Shi. Obwohl die Familie eher zurückgezogen lebte, kannten sie sich aus Schulzeiten und waren Freunde geblieben. Shi erzählte Chens Vater, dass seine Großeltern etwas im Gebet gesehen hätten, die Vision eines schrecklich-grausigen Unglücks, das ihnen allen bevorstand. Deswegen würden sie sich auf den Myoko-Berg zurückziehen und beten. Eine Woche später waren alle auf einen Schlag tot. Sie waren eine der Ersten gewesen.
Der Wald wurde lichter. Chen musste fast eine halbe Stunde unterwegs gewesen sein, doch seit Ashoka hatte er kein Wort mehr gesprochen. Stille war das Gebot der Stunde, wenn er heute erfolgreich sein wollte. Erst an der Waldgrenze blieb er stehen. Vor ihm erstreckte sich eine riesige Grasfläche: Links endete sie einige hundert Meter weiter an einer Schlucht, rechts schien sie bis in die Unendlichkeit zu verlaufen. Am Horizont zeichnete sich der Myoko-Berg ab. Zu dieser Jahreszeit lag sein Gipfel in glitzerndem Weiß, angestrahlt von der aufgehenden Sonne, umgeben vom feinen Dunst des Morgens.
Chen nahm einen Pfeil aus dem Köcher und klemmte die Sehne in die Nocke hinter der Befiederung. Dann legte er sich auf die Lauer. Er musste jetzt Geduld haben. Zeit hatte er immer, die Geduld war stets die Herausforderung. Zeit hatten sie jetzt alle. Früher war es das größte Problem gewesen, so groß, dass sich eine ganze Branche darauf erbaute. Zeitmanagement, effizientes Leben, Work-Life-Balance; Chen dachte damals, sein größtes Problem sei es, zu wenig von dieser kostbaren Zeit zu besitzen. Heute war sie alles, was er hatte, sein Segen und furchtbarer Fluch zugleich. Zeit im Übermaß.
Читать дальше