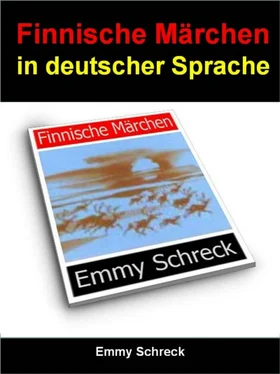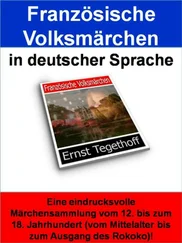Von dir erwartend Beut und Danck,
Dass ich nicht möge dich vergessen
Und meinen guten Bärensang.
Zu welch unerträglicher Geschwätzigkeit sind hier
die zwanzig kurzen trochäischen Verse des Originals
auseinandergezogen!
Das nationale Erwachen Finnlands und das daraus
hervorgehende ernstere Interesse für die im Volke bewahrten
Reste der Vergangenheit datirt – merkwürdig
genug – erst seit der Vereinigung aller finnischen Provinzen
unter russischer Herrschaft, also seit dem Jahre
1808. Man weiss, mit wie weit gehender Selbständigkeit
das Grossfürstenthum Finnland ausgestattet
wurde und wie in Folge dessen der bis dahin übermächtige
Cultureinfluss des Schwedischen immer
mehr und mehr zurück trat. Nun nahm das Sammeln
der Volkslitteratur einen immer grösseren Aufschwung.
Gottlund, Poppius, Topelius und Lönnrot
machten mehr oder minder bedeutende Sammlungen.
Einzelne Kleinigkeiten wurden auch herausgegeben,
das meiste aber blieb ungedruckt, weil die Bücher zu
wenig Interesse und Absatz fanden – man braucht
sich bloss an das Schicksal ähnlicher Unternehmungen
in grösseren Culturländern zu erinnern. Leicht
hätte es gehen können wie mit den Sammlungen des
achtzehnten Jahrhunderts, welche mit sehr wenigen
Ausnahmen durch Feuersbrünste und Unachtsamkeit
wieder verloren gegangen sind. Da erstand allen diesen
Bestrebungen ein Mittelpunkt und Hort in der finnischen
Litteraturgesellschaft. 1831 gestiftet, war sie
besonders dazu berufen, die reichen Sammlungen von
Elias Lönnrot dem finnischen Volke und der Nachwelt
zu erhalten. Lönnrot, geboren 1802, ist am 19.
März 1884, viel betrauert von dem Volke, dem die
ganze angestrengte Arbeit seines Lebens gegolten, dahingeschieden.
Er hat das in diesem Jahre gefeierte
fünfzigjährige Jubiläum der Litteraturgesellschaft
nicht mehr erlebt, deren Schriften in den von ihm besorgten
Veröffentlichungen ihre schönste Zierde besitzen.
Er kann mit Jacob Grimm verglichen werden,
dem er zwar an Genialität und vielseitigem Wissen
nicht gleich kam, wohl aber an hingebender Liebe und
treuer, stiller Arbeit für sein Volk. Noch kurz vor seinem
Tode hat er ein gross angelegtes finnisches Wörterbuch
beendet.
Es sind, wenn wir von den Sammlungen der
Sprichwörter (1842), Räthsel (1844) und Zauberlieder
(1880) absehen, besonders die drei grossen von
der Litteraturgesellschaft veröffentlichten Ausgaben
der epischen Lieder, der lyrischen Gedichte und der
Märchen, welche den grossen Reichthum des finnischen
Volksgeistes erschlossen haben und geeignet
sind auch ausserhalb ihrer engeren Heimat die weitesten
Kreise zu interessiren.
Schon im Jahre 1835 erschien die erste Ausgabe
der von Lönnrot gesammelten epischen Lieder, die
seitdem so berühmt gewordene Kalevala, in zwei
Bänden mit etwas über 12000 Versen in 32 Gesängen.
Fortgesetzte Sammlungen in entlegenen Theilen
des Landes ergaben eine so ungeahnte Fülle bisher
unbekannter Lieder, dass die zweite Ausgabe (1849)
fast um das Doppelte vermehrt war: sie umfasst 50
Gesänge mit fast 23000 Versen. Das Bekanntwerden
dieser epischen Volksdichtungen, die durch wohl
zwei Jahrtausende bloss mündlich fortgepflanzt waren
und bei aller Selbständigkeit der einzelnen Lieder
doch eine fortlaufende und zusammenhängende Handlung
zeigen, war von der grössten Bedeutung für die
Entscheidung der Fragen, die sich überhaupt an Entstehung
und Entwickelung des Epos knüpfen und die
besonders auf dem Gebiete der altgriechischen und
altdeutschen Litteratur zu so hitzig geführtem Streite
Veranlassung gegeben haben. Man kann sagen, dass
die finnische Kalevala in der Mitte der Entwickelungsreihe
liegt, deren einen für uns erkennbaren Endpunkt
die serbischen und südrussischen Heldenlieder,
den andern die Ilias und die Odyssee bilden. Rechnet
man dazu die hohe Bedeutung dieser alten Lieder für
die Erkenntniss eines vor aller Geschichte liegenden
Culturzustandes der Finnen – was bei den bekannten,
linguistisch nachweisbaren Wechselbeziehungen fin-
nischer und germanischer Stämme auch für die deutsche
Alterthumskunde nicht ohne Ertrag war – so wie
die trotz mancher Längen bald in die Augen springenden
hohen poetischen Schönheiten der Lieder, so wird
man die sympathische Begrüssung verstehen, die
Jacob Grimm denselben bereits 1846 zu Theil werden
liess.6
Grimm konnte damals bereits eine schwedische
Uebersetzung des Epos von Alexander Castrén
(1841) benutzen, der sich ebenfalls um die finnische
Alterthumskunde hoch verdient gemacht hat und dessen
letztes Werk eine erst nach seinem 1852 erfolgten
Tode heraus gegebene finnische Mythologie war.7
Auch ins Französische wurde die erste Ausgabe der
Kalevala schon 1845 von Léouzon-le-Duc übertragen,
der auch eine heute natürlich veraltete Studie
über die Urgeschichte, die Mythologie und die epische
Dichtung Finnlands hinzufügte. Nach dem Erscheinen
der zweiten Lönnrot'schen Ausgabe fertigte
Anton Schiefner seine deutsche Uebersetzung der Kalevala
an.8 Man kann nicht behaupten, dass sie der
Dichtung in Deutschland viele Freunde geworben hat.
Sie war weniger von aesthetischen als von philologischen
Gesichtspunkten geleitet. Allerdings waren
auch gegen das philologische Verständniss des Einzelnen
recht viele Einwendungen zu machen, wie das
in ziemlich scharfer Weise in der Besprechung von
Ahlqvist in der finnischen Zeitschrift Suomi geschehen
ist. Im ganzen rechtfertigte die Uebersetzung einigermassen
den herben Witz: »Herr Schiefner hat seine
Arbeit den Manen des edlen Castrén gewidmet; sollte
er über kurz oder lang eine zweite sehr verbesserte
Auflage publiciren, so empfehlen wir ihm, statt jener
Worte, folgenden Vers aus Racine's Phèdre:
›pour apaiser ses manes et son ombre plaintive ...‹«
Ahlqvist hat schon damals auf einige Grundsätze
hingewiesen, welche die Uebersetzer des finnischen
Epos leiten sollten. »Es wäre den Uebersetzern leicht
gewesen der Beschuldigung des Mangels an Formschönheit
zu entgehen, hätten sie nur sich vorgenommen
dasjenige zu ersetzen, was keine Nachahmung
zuliess. Sollten die Uebersetzungen durchaus trochäisch
sein – obgleich der Jambus im Schwedischen wie
im Deutschen viel häufiger gebraucht wird – so
müsste des finnischen Trochäus Beweglichkeit und
Abwechslung ersetzt werden durch Einschiebung
eines oder mehrerer Dactylen, nach Beschaffenheit
des Inhalts. Ferner müsste der Vers dann und wann
einen männlichen Schluss haben ....« und so weiter.
Ich weiss nicht, ob diese Worte Hermann Paul bekannt
gewesen sind, der seine Uebersetzung der Kalevala
jedenfalls ganz nach diesen Grundsätzen ge-
macht hat.9 Sie ist eine treffliche Leistung deutscher
Uebersetzerkunst, in fliessender und geschmackvoller
Sprache, dabei die Einfachheit und sinnliche Naturfülle
des Originals nirgends verwischend, und wird
wahrscheinlich viel dazu beitragen einer hochbedeutsamen
Dichtung der Weltliteratur auch bei uns in
etwas weiterem Kreise Eingang zu verschaffen. Leider
ist Paul nach dem Erscheinen des ersten Bandes, welcher
25 Runen, also die Hälfte des Ganzen, enthält,
gestorben. Hoffentlich wird das, wie ich höre, fertige
Manuscript der zweiten Hälfte bald gedruckt werden.
Читать дальше