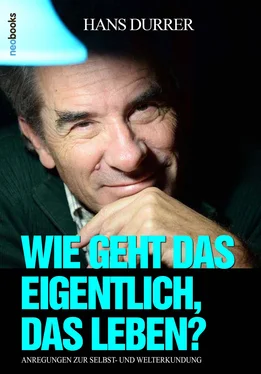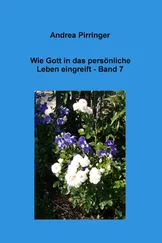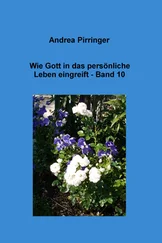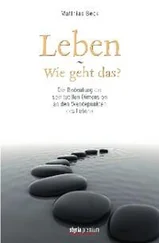Es ist ein Wunder, dass Ameisen aus seiner Abwärtsspirale schliesslich herausfand. Dass er es schaffte, hatte mit ganz verschiedenen Faktoren zu tun, doch entscheidend damit, dass er durch einen Artikel in der „New York Times“ auf ein Medikament namens Baclofen stiess, welches das Verlangen (Craving) nach Alkohol unterdrückt. Craving umfasst körperliche, emotionale und mentale Symptome, die in schlimmen Fällen dem Hunger eines verhungernden Menschen vergleichbar sind: „Die gleichen Hormone werden freigesetzt und die gleichen Gehirnregionen aktiviert. Das Nationale Institut für Alkoholmissbrauch und Alkoholismus (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) hat festgestellt, dass das Verlangen nach Alkohol sogar schlimmer sein kann als Hunger oder Durst und dass, wenn der Alkoholismus den Betroffenen im Griff hat, das Gehirn Alkohol als lebensnotwendig ansieht.“
Baclofen, ein Mittel, das gegen Muskelkrämpfe verschrieben wird, soll das Craving unterdrücken können? Ameisen hatte es im Selbstversuch getestet, und ja, es hatte gewirkt. Ein paar wenige Ärzte haben es bisher an Patienten ausprobiert, und ja, es hat gewirkt. Nein, nicht bei allen. Denn auch wenn man, wie Ameisen das tut, Abhängigkeit als eine biologische Krankheit versteht, muss ein Patient zuallererst immer noch ausreichend mit dem Saufen aufhören wollen.
***
Hätte er besser auf Tante Luci gehört, die Augen fest verschlossen und seine Nase gut abgedichtet, wie es die Delphine tun, wenn sie abtauchen, und nicht am Likörglas gerochen, als Tante Luci es ihm unter die Nase hielt, wäre er vielleicht davongekommen, mutmasst Peter Wawerzinek in „Schluckspecht“. Nur hat er das eben nicht und ist deswegen auch nicht davongekommen. „Vielleicht“, wie er treffend schreibt, denn mit Gewissheit lässt sich so was ja nicht sagen.
Andrerseits weiss und/oder merkt und/oder spürt er, dass er anders trinkt als die anderen aus seiner Gruppe. Er kann nicht aufhören, greift gerade aus dem Koma erwacht zur Flasche, trinkt weiter, wo die Mittrinker längst aufgehört haben.
Am Anfang sei der Säufer noch Mensch, am Ende nur noch Säufer, notiert er einmal und säuft weiter, verflucht seine Inkonsequenz. An hellsichtigen Erkenntnissen mangelt es ihm nicht: „Suff ist Vergessen. Suff nimmt das Leid anderer Menschen nicht wahr. Suff erzeugt Wut auf sich. Suff bringt einen in Schwierigkeit. Man kennt keine Beschaulichkeit mehr ...“.
Der Suff beginnt seinen Alltag zu bestimmen, er ist sich dessen bewusst, gibt weiterhin Unsummen für seinen Alkoholkonsum aus und landet schliesslich im Ulenhof, einer therapeutischen Einrichtung für hoffnungslose Fälle.
Einmal Alkoholiker immer Alkoholiker, meint sein Doktor. Säufer seien ständig in Gefahr, auch wenn sie sich geheilt vorkämen. Gefangene in ihrer Trockenzelle, von angsteinflössenden Suchtträumen heimgesucht. Sie radikal trocken zu setzen, davon hält sein Doktor nichts. „Je länger der Trockenzustand anhält, desto grösser sind die Gefahren. Man schafft es, jahrelang trocken zu bleiben. Und dann, durch allzu grosse Freude, durch Kummer, Trauer, Gram, greift man nach dem einen Schnaps. Und schon beginnt alles mit diesem Einglasschadetnicht wieder von vorne und endet heilloser als je zuvor.“
Ich halte die Überzeugung „Je länger der Trockenzustand anhält, desto grösser sind die Gefahren“ für ausgemachten Blödsinn, denn es ist nicht die Länge der Trockenheit, die zählt, sondern die tägliche Lebensqualität. Mit dem Saufen aufzuhören ist für Säufer die Grundbedingung, ohne die ein anderes, neues, gesünderes Leben nicht möglich ist.
Peter Wawerzinek sieht das anders. In einem Interview mit dem 'Deutschlandfunk' meinte er, er habe sich die 'Drei-Drinks' angewöhnt. „Das heisst also drei Gin Tonic, wenn ich abends weg bin, oder höchstens drei kleine Sektgläser. Immer drei, drei, drei. Wähle 333 am Telefon. Das hat sich dann so ergeben mit diesem Therapeuten, mit dem Dr. Gredig, der so ein Hippie-Typ gewesen ist und das Problem von mir gleich erfasst hat. Vollalkoholiker auf ein Mass zurückzubringen, das ist schon ein Erfolg. Ich will nicht trocken sein ...“.
Nur eben: es geht nicht darum, trocken zu sein. Es geht darum, sich mit sich selber wohlzufühlen. Und ohne sich dabei selber zu betrügen.
***
Wie alle Alkoholiker, wollte Bernd Thränhardt keiner sein. Ein Alkoholproblem zu haben, klang akzeptabler. Er versuchte es mit kontrolliertem Trinken und merkte, dass das nur an Tagen ohne Probleme, Belastungen und Erschütterungen, in denen ihn seine Freundin nett und liebevoll behandelte, und seine Auftraggeber allesamt dankbar und zahlungswillig waren, funktionierte. Nur waren die meisten Tage seines Lebens nicht so. „Kränkungen, Enttäuschungen und Niederlagen gehörten unverzichtbar dazu. An diesen Tagen zerriss mich die Gier nach Alkohol, die von den abendlichen Bieren eher angefacht als eingedämmt wurde“, notiert er in „Ausgesoffen“.
Er landete auf der Suchtstation eines städtischen Krankenhauses, wo er die Erfahrung machte, dass unter den Leidensgenossen schnell eine grosse Vertrautheit entstand und es ihm im Raucherraum leichter fiel, offen über seine Schwächen, Probleme und Ängste zu reden als im Arztzimmer. Eine Erfahrung, die er später in Selbsthilfegruppen fortsetzen sollte. Doch kaum war er aus der Klinik raus, begann er wieder zu saufen.
Mit 44 zog er wieder bei seinen Eltern ein, schlief in seinem Jugendzimmer und brach nachts in den elterlichen Weinkeller ein. Der Alkohol hatte sein Leben verwüstet, es gelang ihm nicht, davon zu lassen. Dann fand er Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern, von denen er sich jedoch nach einigen Jahren wieder trennte: sie wirkten auf ihn zu ideologisch, zu religiös geprägt, zu wenig das Individuelle berücksichtigend. Ich teile zwar seine Aversion gegenüber den AA-Hardlinern, doch dass das Individuelle bei den 12-Schritten auf der Strecke bleibt (und womöglich bleiben muss), hat seinen Sinn und Zweck, denn was alle Alkis verbindet, ist bekanntlich, dass sie alle glauben, ganz anders als alle anderen zu sein.
***
„Der Depressive hält an einem verzerrten Wunschbild seines Lebens fest ... Falsche, aber lange Zeit verlockende Illusionen und Zerrbilder aufzugeben, ist der Preis für ein normales Leben“, behauptet Holger Reiners in „Das heimatlose Ich. Aus der Depression zurück ins Leben“.
Das erinnert an Suchtkrankheiten: Auch wer diese überwinden will, muss Illusionen und Zerrbilder aufgeben. Und das tut man, indem man Hilfe von aussen sucht. Der erste Schritt ist, zu erkennen, der Krankheit nicht alleine gewachsen zu sein. Was Horst Zocker in „betrifft: Anonyme Alkoholiker“ über die Alkoholsucht notiert, gilt meines Erachtens für alle seelischen Leiden: „'Nur du allein schaffst es', sagen sie, 'aber du schaffst es nicht allein.' Das ist auch so eine Kalenderweisheit. Sie stimmt . Ich habe es erlebt.“
Will man Depressionen oder Suchtkrankheiten überwinden, muss man lernen, sich für das Leben zu entscheiden. Nötig ist also eine grundsätzliche Neupositionierung. Ob etwa die Psychoanalyse in dieser Hinsicht hilfreich sein kann, ist mehr als fraglich. Denn diese, so ein anonymer New Yorker Analytiker in Janet Malcolms „Psychoanalysis. An Impossible Profession“, gehe davon aus, dass wir unser Leben einem Wiederholungszwang folgend leben und durch die Analyse kleine Abweichungen möglich würden, etwa fünf bis zehn Grad, vielleicht sogar fünfzehn Grad nach rechts oder nach links. Auch Holger Reiners hat beobachtet, dass Menschen, die sich im fortgeschrittenen Alter ändern wollen, zwar eine Richtungsänderung vornehmen können, allerdings höchstens in einem Winkel von zwei, maximal drei Grad. Jedoch: „Beim Depressiven verhält sich die Situation anders – und das kann Mut machen. Einem einst Depressiven traue ich eine Änderung seines Lebenskurses sogar um 180° zu, und nicht nur das, ich bin heute davon überzeugt, dass er eine solche Kursänderung nicht nur irgendwann akzeptiert, sondern sie auch aus gewonnener Erkenntnis ganz selbstverständlich anstrebt.“
Читать дальше