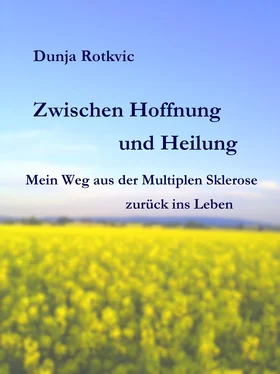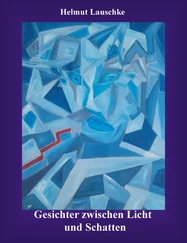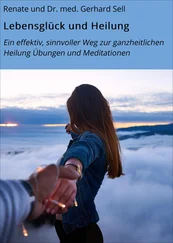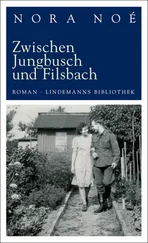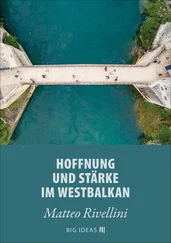In dieser frühen Phase war es aber vor allem die Krankheitsdiagnose selbst, die auf meinen Schultern lastete und mir die Leichtigkeit meines jungen, bis eben noch unbekümmerten Lebens nahm. Es kamen noch einige kleinere Schübe hinzu, Empfindungsstörungen in den Fingern, eine kaum sichtbare Gangstörung, Probleme mit der Handmotorik, aber sie legten sich wieder. Alles Krankheitssymptome, die nicht angenehm waren, natürlich nicht, ich musste nun besser auf mich aufpassen, durfte mich nicht mehr unvorsichtig überlasten, aber im Grunde genommen blieb alles noch im Rahmen. Ich hatte doch gar keine Ahnung in diesen Anfangsjahren, was eine solche Krankheit alles zu verändern vermag, welche Macht sie besitzt und wie unbarmherzig sie zuschlagen kann. Dann kam eine Zeit des Zur-Ruhe-Kommens und der körperlichen Regeneration, in der ich sehr auf mich achtete, das Rauchen aufgab, von dem ich so schwer loskam, und das Trinken, dem ich sowieso nie viel abgewonnen hatte. Es war, als ob diese Krankheit mir einen Grund gegeben hätte, ruhiger zu werden, langsamer zu treten. So wurde ich innerlich gelassener, äußerlich wurde ich runder. Die langen schönen lockigen Haare kamen ab, die Rettungsringe hinzu, aber mich störte das nicht. Ich wollte keine besondere Aufmerksamkeit erregen in dieser Zeit, weil ich die Stille in meinem Leben genoss, die Unaufgeregtheit und Strukturiertheit dieser Tage, die familiäre Atmosphäre unseres kleinen Studentenkreises. Im Grunde genommen war dies eine schöne, eine gelassene Zeit. Aus der exaltierten, unausgeglichenen und erlebnishungrigen jungen Frau war eine ruhige und gemütliche Person geworden. Ich fühlte mich lange wohl in diesem Zustand, bis er mich irgendwann doch wieder zu langweilen begann. Ein Leben auf Sparflamme, das konnte es nicht sein. Es ging mir doch gut. Die Krankheit hatte sich ganze zwei Jahre nicht mehr gemeldet. Eigentlich hatte ich alles im Griff. Und außerdem, vielleicht hatten sich ja auch alle geirrt.
Die Ärzte und ich, ein schwieriges Thema, ich hätte es gerne anders gehabt. Aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich mir überhaupt durch die gängigen Methoden helfen lassen? Mein großer Traum ist ein Naturarzt, schulmedizinisch versiert, alternativmedizinisch engagiert, professionell und doch herzlich, der erfahren genug ist Heilung als einen ganzheitlichen Vorgang anzuerkennen und daher wirklich daran interessiert ist, mit seinen Patienten zusammenzuarbeiten. Dabei bin gerade ich sicherlich keine einfache, weil informierte und manchmal auch eigensinnige Patientin. Doch inzwischen habe ich tatsächlich Ärzte gefunden, die diesem meinem Idealbild in gewisser Weise entsprechen, denen ich vertraue und deren Meinung und Rat ich mir gerne einhole. Aber ich musste lange suchen. Am Anfang stand erst einmal der Schock über die Diagnose, die Hilflosigkeit, wie ich dieser Krankheit zu begegnen hatte, und eine Neurologin, die freundlich war und jung, aber im Grunde genommen fast genauso ängstlich wie ich. Zumindest war sie sehr zurückhaltend und vorsichtig. Sie klärte mich kurz über die möglichen Verlaufsformen der Multiplen Sklerose auf, sagte ansonsten nicht viel, drückte mir stattdessen ein Buch in die Hand, für das ich ihr heute dankbar bin, denn es hat meine gesamte Einstellung zu dieser Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten maßgeblich geprägt. Damals jedoch fand ich das alles sehr wenig.
Dr. med. Wolfgang Weihe, Neurologe und MS-Spezialist, verfasst Aufklärungs- und Ratgeberbücher zur Multiplen Sklerose, die sich explizit am Patienten und dessen Bedürfnis nach unabhängiger Information orientieren und ein differenziertes, in vielem sogar durchaus positives Bild von der Krankheit und ihren Behandlungsmöglichkeiten zeichnen:
Wolfgang Weihe: „Multiple Sklerose. Eine Einführung“, 5. aktual. Aufl. 2010.
Wolfgang Weihe: „Was Sie schon immer über die Multiple Sklerose wissen wollten. 310 Fragen und Antworten zur MS“, 2003.
Wolfgang Weihe: „Warum die Multiple Sklerose besser ist als ihr Ruf. Ein Wegweiser für Neubetroffene“, 2. erweiterte Aufl. 2009.
Dann gab sie mir noch den Tipp, mein Beschäftigungsverhältnis zu überdenken, und entließ mich. Einige Zeit später, als sich bei mir erneut leichte Taubheitsgefühle, diesmal in den Fingern, einstellten, war sie schon wieder im Urlaub. Genauso wie damals, als ich gerade aus dem Krankenhaus gekommen war. Ich war dann zu ihrem Kollegen weitergereicht worden, ein älterer, grauhaariger Herr, freundlich, aber nicht übermäßig interessiert, ein aufklärendes Gespräch mit mir zu führen. Ich erzählte ihm von den Nebenwirkungen der hoch dosierten Cortisoninfusion. Noch am Infusionsgerät hängend, hatte sich ein starker Druck in meinem Kopf breit zu machen begonnen und das Gefühl setzte ein, wie unter einer Glaskugel von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Bald darauf kamen heftige depressive Verstimmungen hinzu, all meine Emotionen schienen unaufhaltsam ins Negative zu kippen. Ich hatte das Gefühl, dem nicht entgegenwirken zu können, fühlte mich schlecht, war unzufrieden, gereizt, bis alles genauso plötzlich wieder vorbei war, einige Tage nachdem die Cortisonbehandlung beendet wurde. Der Arzt tat einen Zusammenhang ab und interpretierte meine Beschwerden als psychische Reaktion auf die Diagnose. Mir aber war der zeitliche Zusammenfall von Cortisongabe und tiefster Schwermütigkeit Beweis genug und ich fühlte mich von ihm einfach nicht ernst genommen. Tatsächlich weiß ich heute, dass depressive Stimmung und Gereiztheit neben der so typischen Euphorie und Antriebssteigerung häufige Begleiterscheinungen längerer Cortisonbehandlungen sind. Aber auch während oder nach einer kurzfristigen Pulstherapie, wie ich sie erhalten habe, gerade weil diese sehr hoch dosiert ist, können sich starke depressive Verstimmungen einstellen. Sogar dieser immense Druck, den ich in meinem Kopf verspürte, lese ich, stellt eine mögliche Nebenwirkung der Cortisonbehandlung dar. „Pseudotumor cerebri“ wird das Gefühl einer Anschwellung des Gehirns genannt.
Nebenwirkungen der kurzen hochdosierten Cortisongabe können sein: Oberbauchbeschwerden bis hin zu Blutungen, Entgleisung von Blutzucker, Blutdruck und Elektrolyten, Thrombosen, epileptische Anfälle, generell psychische Symptome wie Depression, Euphorie, psychotischer Anfall. Falls man ein Risikopatient in einem dieser Bereiche sein sollte, ist erhöhte Vorsicht anzuraten. Auch während eines akuten Infekts sollte kein Cortison verabreicht werden, da die immunhemmende Wirkung kontraindikativ ist. Im Normalfall wird die Cortison-Pulstherapie jedoch ganz gut vertragen. Auf viele Patienten wirkt sie geradezu euphorisierend. (Schmidt; Hoffmann: „Multiple Sklerose“, 2012, S. 250-256.)
Ich muss schmunzeln, komme mir vor wie mein eigener Arzt, will es ganz genau wissen, denn ich hasse das Gefühl, ausgeliefert zu sein, dem Dünkel anderer zum Beispiel. Dr. Weihe, mein Lieblingsneurologe auf Papier, sieht das Cortison als ein lebensrettendes und wichtiges Medikament an, das aber verantwortungsvoll und überlegt zu verabreichen sei. Er rät bei „leichteren“ Symptomen ev. auf erhöhte Vitamingaben bzw. eine Enzymtherapie auszuweichen. Das war ganz nach meinem Sinne. Aber leider blieb dieser Arzt für mich ein Ratgeber auf Papier, der im Ernstfall nicht konsultierbar war.
Da Cortison eigentlich ein Stresshormon ist, das die Wundheilung und die Immunabwehr unterdrückt, fragt sich Wolfgang Weihe, inwieweit die offensichtlich positive Wirkung des Cortisons, d. h. ein schnelles Abklingen der Symptome, tatsächlich eine positive Wirkung auf notwendige Heilprozesse darstellt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Cortison eigentlich nur auf die schnelle Abschwellung des Umgebungsödems einer Entzündung hinwirkt, weil es das Wasser aus dem geschwollenen Gewebe aussaugt. Hierdurch kommt es zu einer Linderung der Beschwerden, da der Druck auf die Nerven, die das Entzündungsgebiet durchqueren, nachlässt. Die Frage sei nun, ob ein rasches Abschwellen des Entzündungsödems tatsächlich immer sinnvoll ist, denn das könne eventuell dazu führen, dass es zu einer zu schnellen und unvollständigen Narbenbildung komme und damit die Entstehung von chronisch aktiven Herden gefördert wird. (W. Weihe: „Multiple Sklerose“, 2010, S. 161, generell S. 157-169.)
Читать дальше