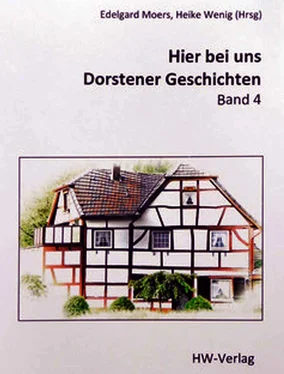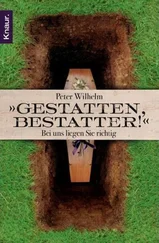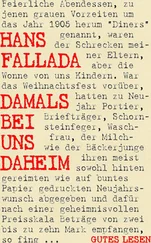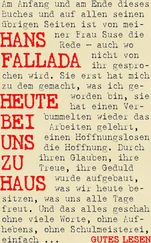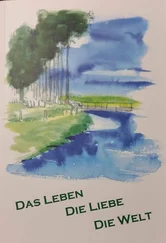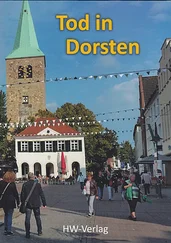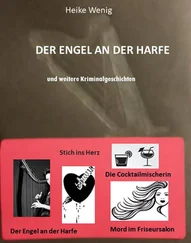Es hat also in Dorsten ein edelfreies Geschlecht der Edelherren von Dorsten geherrscht, das mit Imeza als letzter Edelfrau von Dorsten endete. - Die auch in den Xantener Totenbüchern genannte Frau Reginmuod war dagegen eine Frau von Ulfte, die nach Imeza (nach 1075 und vor 1100) gestorben ist. Diese Reginmuod ist als Stifterin der Xantener Höfe in den Herrlichkeiten Raesfeld und Lembeck in Betracht zu ziehen.
Dorsten kommt durch die Schenkung der Edelfrau Imeza im 11. Jahrhundert in den Besitz des Kanoniker Stiftes zum hl. Viktor in Xanten. Dieses Dorsten besteht aus einem adeligen Hof und zugehörigen Unterhöfen entlang von Schölzbach und Barloer Bach, ferner aus Zehntrechten an zahlreichen Höfen im Vest Recklinghausen. Diese Villikation des Oberhofes Dorsten ist die bedeutendste im Vest Recklinghausen und die Schenkung der Imeza ist die größte für das reiche Stift am Niederrhein. Für Imeza war nach der persönlichen Katastrophe des Verlustes ihres Mannes und dem frühen Tod ihres kleinen Sohnes und Erben die Übersiedlung in das Stift religiöser Trost. Aus dem Oberhof Dorsten und seinem Hofverband kommen dem Stift große Einkünfte an Naturalien und Geld zu, die der Kellner als Wirtschaftsverwalter einzieht. Die Xantener Totenbücher, Güter- und Einkünfte Verzeichnisse gehören zu den wichtigen Überlieferungen für die Dorstener Geschichte. Sie sind die wichtigsten historischen Quellen für den Zeitraum vom 11. bis 13. Jahrhundert und weit darüber hinaus für den kirchlichen und agraren Bereich. Das Stift Xanten als Träger der Pfarre ist organisatorisch und geistig die wichtigste Institution im Mittelalter bis zur Reformation. Auf das Stift Xanten geht die Gründung des Kirchdorfes Dorsten zurück, das 1251 zur Stadt erhoben wurde. Dem Stift Xanten verdankt die Stadt Dorsten die Aufbewahrung der Gründungsurkunde vom 1.6.1251. Für den ländlichen Dorstener und vestischen Raum enden erst mit der Säkularisation 1802 die Reste der Xantener Grundherrschaft.
Diese Geschichte ist eine Brücke über lange Zeiten. Sie zeigt uns Entwicklungen auf, die für Jahrhunderte den Menschen das Leben ermöglichten. Die Bindung Dorstens an das Stift war zugleich die Bindung an den Niederrhein mit seiner höheren Entwicklungsstufe. Das Stift hat wirtschaftlich und kulturell Dorsten gefördert. Andererseits haben die Einkünfte des Stiftes aus der großen Schenkung der Dorstener Frau Imeza das Stift bereichert, wozu sicher auch ein Beitrag zu den materiellen Voraussetzungen für den Bau des Xantener Domes zu rechnen ist. Dieser Dom bleibt das sichtbare Zeichen der Verbundenheit. Dies ist er insbesondere auch durch die höchst ehrenvolle Begräbnisstätte der bedeutendsten Frau in der Dorstener Geschichte, nämlich der Edelfrau Imeza. Sie hat eine persönliche Katastrophe erlebt, aber ihre Entscheidung zum religiösen Leben im Stift hat für Dorsten große Folgen gehabt.
Hannes als Pennäler am Petrinum
Hannes kam auf das humanistische Gymnasium seiner Vaterstadt. Auf das Gymnasium Petrinum. Das Grün der Sextanermütze tauchte seine Sommersprossen in ein versöhnendes Licht. Die Farbe stand ihm gut. Es kam ihm vor, als habe eine neue Welt begonnen. Mit Eifer deklinierte er agricola: der Landmann. Er konnte es im Schlaf. Das Gymnasium war ein großer, aber nüchterner Bau. Die Nähe des Klostergartens wärmte seinen kalten Stein. Ein befreiender Blick aus seinen Westfenstern über das weite Land bis zu den Hardt Höhen gab dem Studium in diesen Räumen ein freundliches Gepräge. Des hohen Hauses Allgewaltiger war „Zeus“, der lebende Altgrieche. Lang aufgeschossen und hager, mit einem Gesicht, das an den leidenden Christus erinnerte, war er die ideale Verkörperung des Humanisten. In nachtwandlerischer Traumsicherheit schwebte er über den Gefilden Hellas, und sein Geist dehnte sich auf seinen Fluren bis an die „sonnenfingerige Eos“. Las Hannes’ Klasse mit ihm die Odyssee, geriet er jeweils in Verzückung. Er ließ die Sprache klingen und bei seiner wortgewaltigen Übersetzung zündete er bei seinen Schülern das Feuer und weckte in ihnen die innere Bereitschaft für dieses sein geliebtes Land. Er war einer der letzten großen Zeugen dieser seiner Welt. Was an Sonne und Schönheit und Größe und Sehnsucht von hier über die ganze Menschheit ausgestrahlt war, hatte er dürstend aufgefangen und wurde so der begnadete Mittler zwischen gestern, heute und morgen.
Nicht minder war dieser Schwabe ein Schwärmer für die deutsche Sprache. Meisterhaft, mit tiefstem innerem Nacherleben wusste er Gedichte von Hölderlin oder Mörike zu sprechen. „In ein freundlich’ Städtchen tret’ ich ein …“. Bis in sein hohes Alter hat dieser Schöngeist eine glühende Begeisterung für alles Edle und Große in sich wachsen und blühen lassen. Noch lange sah man ihn wie auf fernen Spuren wandelnd „makra bibas“ durch die Straßen der alten Stadt schreiten.
Des „Zeus“ engster Mitarbeiter war sein Pedell, der kleine Antonius Klingelberger. Er wird unvergessen bleiben. Er war Leichtgewicht und reichte dem „Alten“ bis an die Kniekehlen. Seine Füße stellte er stark nach außen, und als ehemals leichter Kürassier hatte er einen köstlich wippenden Gang. Daran waren die Pferde schuld. Sein riesiger Schnurrbart, etwas rötlich angehaucht, verdeckte die Hälfte seines schmalen Sergeanten Gesichts. Er war sein Prunkstück. Er hing an ihm und pflegte ihn mit Inbrunst. Pflichtbewusstsein und Pflichteifer saßen ihm tief in den Knochen. Er war peinlich gewissenhaft und ein Musterbeispiel dienender Treue. In die alte Stadt passte er haargenau hinein, und sein Bürgersinn trat lobend bei allen Volksfesten in Erscheinung.
Antonius wohnte in der Belvedere an der Stadtmauer. Heckenrosen und wilder Wein umrankten sie. Der nahe Patersgarten grenzte nach Norden an, und der Gesang der Vögel des heiligen Franziskus drang in jede ihrer Kammern. Wenn die Rosen blühten, war sie wie ein verwunschenes Schloss.
Die Ehehälfte des kleinen Pedells war Germanentyp und hatte viel Kraft und Molligkeit. Sie war eine üppige Frau. Beide passten nicht in diese träumende Burg mit ihren blühenden Rosen. Hochragend über die Stadtmauer hinweg, war sie ein Stück lebendiger Vergangenheit, und hinter ihren mit Holz verkleideten Wänden raunte die alte, behäbige und besinnliche Zeit. Hier stockte der laute Atem der Welt, hier hätte man Verse schreiben können. Die Ehe war nicht ohne Spannungen. Er fürchtete ihre Nähe und war in ihrer Reichweite mehr als untertänig. Nur beim Schwingen des Schulbesens fühlte er sich stark, aber auch nur dann, wenn beide ein Stockwerk auseinander waren. Ihre Liebe saß nicht tief.
Antonius war bösartig. Er war es geworden. Er lag ständig auf der Lauer, hinter allem vermutete er einen Schabernack. Schon ein leichtes Rappeln des Morgens mit der Klinke der großen, verschlossenen Schultür brachte ihn in Siedehitze. Er war im Grunde ein armer Kerl. Er fand keine Einstellung zur Jugend. Der Kasernenhof hatte ihn verdorben. Was er früher und auch jetzt noch mit „Hände an der Hosennaht“ einstecken musste, warf er in doppelter Auflage wieder auf die, die er beherrschte. Jene Warmherzigkeit eines väterlichen Freundes war seinem Wesen fremd, ohne Feierabendfreude schritt er seinen kleinen Pfad, gehetzt von dem „Alten“ und seinen Professoren und gequält von der Jugend, die seine Schwäche bald erkannt hatte. Alles Klingen in ihm, das er sicherlich einmal besaß, war verstummt. Vieles stritt er selbst durch. Oft in Schweiß gebadet. Wenn ihn aber seine Kräfte verließen, und er die Schuld nicht heimzahlen konnte, klagte er an. Wehe, wenn nun der klassisch-blaue Aktendeckel aus dem Zimmer des „Alten“ auf Wanderschaft ging. Wie ein König wippte Antonius dann triumphierend durch die Hallen und Klassenzimmer, allen Kummer und Ärger und Gram vergessend, rankten seine Schnurrbartspitzen gen Himmel, und durch seinen Mund floss es wie Honigwasser. Sein Freund und Gebieter, der mächtige „Zeus“ hatte zu seinen Gunsten entschieden.
Читать дальше