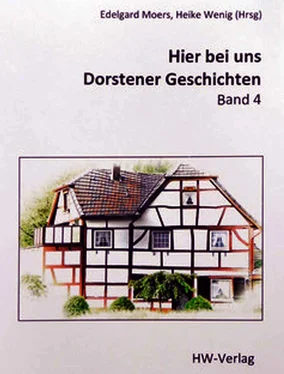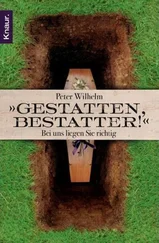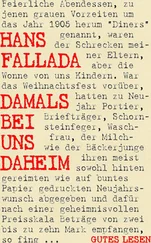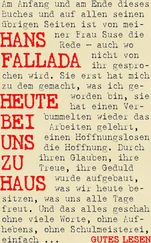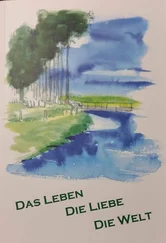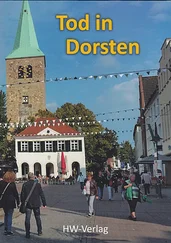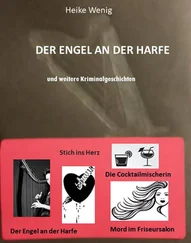Wenn er mit übergeschlagenen Beinen in den kleinen Garten hineinträumte und unter dunkel bewimperten Augen mit sich und der Welt zufrieden auf Blumen und Vögel schaute, war es, als hätte Gott einen dicken, freundlichen Pusteengel vom Himmel fallen lassen. Das war Friedrich, in dieser Weise Hannes meilenweit überlegen.
Klein und hager, ernst und sinnend, dabei klug und von beharrlicher Zähigkeit, war aus altem Bauerngeschlecht Hannes´ Vater. In der geruhsamen Stille und Einsamkeit ländlicher Abgeschiedenheit war er in Einfachheit und Strenge aufgewachsen. Der ihn umrauschende Wald und Berg hatten Geist und Charakter geformt. Hannes fand sich in seiner Jugend nur schlecht mit ihm zurecht, und mehr als einmal schnurrte über ihm die schlanke Gerte aus der dicken Hecke von Bestens Garten.
Im Schatten und unter dem Geläut der Glocken der Pfarrkirche war Hannes´ Mutter geboren und groß geworden. Sie war ein echtes Kind ihrer Scholle und saß voll Sonne und Lebenslust. Ihre Ahnen waren schon viele Jahrhunderte angesehene und fleißige Bürger dieser alten Stadt, und so trug sie aufgehäuft in ihrem immer frohen Herzen die Bilder der Heimat wie einen nie versiegenden Quell. Wie konnte sie erzählen! Wenn Hannes ihrer reichen, schwärmerischen Seele lauschte, öffnete die alte Stadt weit ihre Tore, und alle bunten Gassen, Stiegen und Winkel wurden lebendig. Im Turm der Kirche war sie ebenso zu Hause wie an der Pumpe vor dem Alten Rathaus, und alle Seligkeit ihrer ungetrübten Jugend ließ sie tief in sich einströmen. O strahlendes Bild der Mutter im Zauber der alten Stadt!
Wie ein flügger Vogel zirpte sich Hannes in seinen jungen Morgen hinein. Fliegen brauchte er nicht, aber er musste laufen lernen. Haus und Garten waren seine Welt. Durch seine Feuerlocken blies lustig der Wind, und der kirschrote Mund fand die ersten Worte und Weisen. Die Sommersprossen kamen von selbst. Vom Regenwurm bis zum Apfel steckte er alles in sein kleines Maul. Wenn Gott die Erde tränkte, bekam er jedes Mal einen kräftigen Stritz mit, und da er jeden Tag in die Sonne lief, schoss er wie ein Pilz in die Höhe.
In der Schule am Kirchplatz hatte der erste Ernst des Lebens sich aufgetan. Auf seinem Pult saß der „Herr Lehrer“. Wie der Herrgott auf seinem Thron. Voller kindlicher Scheu blickte Hannes zu ihm auf. In seinen Augen war er der Inbegriff aller Weisheit und Macht. Die Lehrerinnen waren schwarz gekleidet. In jungfräulicher Scham trugen sie hohe Börtchen mit weißen Spitzen. Ihr Leben war nur Gott und der Jugend geweiht. Dabei wurden sie sehr alt und waren oft ungenießbare „Gaffeltangen“. Hannes war nicht dumm. Er hatte den Bogen bald spitz. Sein alter Lehrer hatte stets Freude an ihm. In der großen Pause rannte alles gleich lärmenden Spatzen auf den Kirchplatz. Wie junge Füllen sprangen sie durcheinander. Unter den blühenden Linden war der Sommer eine Lust.
Der Winter hatte seine besonderen Mucken. Es war oft grimmig kalt. Angebraten von dem immer glühenden Kanonenofen, fror man draußen umso mehr. Wenn der Wind über den Kirchplatz pfiff, kroch alles an die Kirchenmauer und suchte zwischen den vorstehenden Pfeilern Schutz.
In der Schule saß Ackermann in der Bank neben Hannes. Kernig und strotzend gesund, trug er egal einen braunen Manchesteranzug und hatte stets einen Geruch von frisch gepflügter Erde an sich. Er war wie die Sommervögel in allen Hecken und Gärten zu Hause. Es schien, als wenn aus seinen großen, tiefliegenden Augen nur der blaue Himmel sah und seine Gedanken beim Unterricht über den weiten Wiesen der Feldmark hingen. Er passte nie auf. Er war wie aus der Scholle gebrochen; beraubt der ungebundenen Freiheit, stemmte er seine trotzige Seele gegen den bitteren Zwang. Ein großes, mutiges Unterfangen von Ackermann. Aber das sollte ihm schlecht bekommen. Sein alter Lehrer hatte dafür kein Verständnis. Tagaus, tagein tanzte auf Ackermanns prallem Hintergewölbe lustig das Marterholz. Wie herrlich knallte das. Dabei staubte seine Hose ungemein.
Imeza, die Stifterin Dorstens
Seitdem es eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte Dorstens gibt, d.h. seit 1851, als der gebürtige Dorstener Julius Evelt (*1823), Professor für Kirchen-geschichte in Paderborn, die Dorstener Geschichte untersuchte, ist die Frage umstritten: Wie kommt Dorsten in den Besitz des Stiftes Xanten? Evelt vermutete, eine Gräfin Reinmod habe Dorsten übertragen, denn sie ist als Stifterin von Kirchen und Kapellen in der Zeit um 1030 im Bistum Münster nachgewiesen. Um 1900 bestreitet der Dortmunder Archivar Karl Rübel eine solche Schenkung, denn wie sollte wohl ein Reichshof in den Besitz dieser Frau gekommen sein? Die Frage ist allerdings auch in der Xantener Überlieferung seit 1300 verworren.
Alle die verschlungenen Wege und Vermutungen von 800 Jahren hier einzeln aufzulösen, würde zu verwirrend sein. Ich trage mein Ergebnis vor. Dabei habe ich die bisherige Fragestellung zum Namen und zum Todesjahr der Frau erweitert auf ihr persönliches Schicksal und den Zeitgeist des 11. Jahrhunderts.
Im 11. Jahrhundert, sicher vor 1075, wahrscheinlich vor 1044, hat Imeza, die letzte Edelfrau von Dorsten, ihren Hof mit allen seinen Rechten und Besitzungen an das Stift Xanten vermacht. Der Name Imeza, geschrieben mit z, gesprochen aber mit stimmlosem S, ist altniederdeutsch, er wird mittelniederdeutsch zu Emese. Als sie diese Schenkung machte, war sie Witwe, und ihr Sohn war als kleines Kind gestorben. Erbenlos suchte sie Trost im geistlichen Leben.
Sie erhielt eine dotierte Planstelle im Stift, eine von 48 Präbenden oder Pfründen. Sie hatte allerdings im Konvent kein Stimmrecht. Eine solche Schenkung und rechtliche Stellung in einem geistlichen Institut ist zwar selten, aber nicht beispiellos. In ihrem Testament setzte sie den Pfarrer von Xanten als Erben ihrer Stelle im Stift ein, allerdings bekam er weder Stimmrecht noch Einkünfte. Die Einkünfte vermachte Imeza an die Gemeinschaft zu gleichmäßigen Anteilen für alle Kanoniker. Das Stift akzeptierte dieses Testament. Das Grab Imezas liegt an einer höchst ehrenhaften Stelle in der Stiftskirche: auf dem Hochchor, zwischen dem Chorgestühl und vor dem mittleren Lesepult, in der Nähe der Märtyrergräber. Die Grabplatte ist 1640 anlässlich der neuen Bedeckung des Bodens entfernt worden. Bei der Ausgrabung im Dom im Jahre 1934 wurde der große Steinsarkophag wieder entdeckt. Zu allen Hochfesten des Kirchenjahres wurde in der Messe der Stifter und Stifterinnen gedacht. Einen persönlichen Gedenktag hatte Imeza am 13. November, dieser wurde auf das feierlichste begangen, denn Imeza galt als die größte Stifterin und Wohltäterin Xantens. Allerdings endete das ewige Gebet mit der Säkularisation des Stiftes im Jahre 1802.
Worin liegt die Ursache der Zweifel und die Unkenntnis vom genauen Todesjahr? Der Brand im Jahre 1109 hatte den gesamten Urkundenbestand des Stiftes vernichtet, darunter auch das Totenbuch, in dem der Todestag Imezas verzeichnet war. Jedenfalls muss dies gefolgert werden aus dem Umstand, dass im Totenbuch von St. Gereon der 16. November als Gedenktag für die Witwe Imeza verzeichnet ist. Vorlage kann nicht das erhalten gebliebene Totenbuch sein, das nach 1044 neu angelegt wurde. Eine leere Seite dieses Buches benutzten um 1100, wohl um 1109, zwei Schreiber um die folgende Geschichte aufzuschreiben: Über das Mahl der Frau Imeza und das Mahl des Erzbischofs Anno. Wir schreiben über dieses Mahl, weil meistens und fast jährlich die beiden Mähler nicht getrennt, sondern zusammen gefeiert wurden, so dass darüber Beschwerden geführt wurden. Es ist deshalb zwischen den Kanonikern und dem Dekan eine Übereinkunft getroffen worden, indem für das Mahl des Anno wie für das Mahl der Imeza eine bestimmte Menge an Lebensmitteln und Getränken festgesetzt wurde, während früher die Mengen unbegrenzt waren. Es werden dann die Sonderzuteilungen zur Feier des Gedenktages genannt, die in ihrer Menge, z.B. von 10 Fleischgängen, überraschen mögen. Aber diese festlichste Gedenkfeier begann mit der Vigil und dauerte den 1. und 2., wahrscheinlich auch 3. Feiertag. Nach dem Vorbild des Totenmahls der Imeza stiftete Erzbischof Anno von Köln sein Gedächtnismahl. Da des Erzbischofs Todestag und -jahr 1075 bekannt ist, liegt das Todesjahr der Imeza früher. Später ist an die Stelle des Mahls die Geldzahlung getreten. Im späten 12. Jahrhundert hat man an die Geschichte vom Mahl der Imeza die Notiz angeschlossen: Der Oberhof Dorsten zahlt an die Xantener Kirche jährlich 15 punt Roggen und (Lücke) Malter außer den Roggenfudern. Dies ist eine Menge von 115 Maltern Roggen und etwa 22 weiteren Maltern. Diese Eintragung geschah, als man in Xanten hinter die Stifter die Erträge aus ihren Stiftungen einsetzte. Hier ist also das älteste Zeugnis über den Zusammenhang von Imeza und ihrer Stiftung Dorsten. Diese Schenkung setzt voraus, dass Imeza Eigentümerin des Hofes Dorsten, nicht nur Inhaberin eines Lehens war. Hier erinnern wir uns, dass bereits um 900 die Grundherrschaft des Abbo und der Athalgard bestand. Gut 100 Jahre später war Imeza Inhabern dieser Grundherrschaft.
Читать дальше