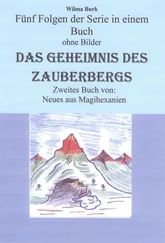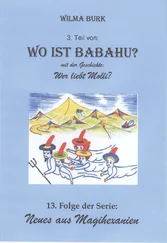Und so war es dann. Statt weniger, kamen schlagartig mehr Menschen zum Einkaufen in die westlichen Orte am Rande der ehemaligen Grenze, sogar von weit her. Sie gingen auch nicht mehr scheu zwischen den Regalen hindurch. Vereinzelt kam sogar dieser oder jener stolz mit einem Westwagen angefahren und packte den Kofferraum voll mit allem, was er erstehen konnte. Dabei fand darin viel mehr Platz, als vorher in einem Trabi.
Es fiel schwer, das zu verstehen, waren die Geschäfte drüben bei ihnen jetzt doch voller Waren. Und trotzdem kamen sie zu uns mit ihren mit D-Mark frisch gefüllten Portmonees. Sie stürzten sich regelrecht in einen Kaufrausch. Weiterhin wurden Berge von Bananen und Apfelsinen gekauft, nun aber auch Kleidung preiswerte transportable Radios, Stereoanlagen und Fernseher. Das ging weg bis zum letzten Stück. Bald hieß es in den Geschäften: „Ausverkauft, die nächste Lieferung kommt dann und dann.“ Und die Geschäftsleute konnten sicher sein, auch diese Lieferung würden sie wieder völlig loswerden. So mancher Ladenhüter mag da noch seinen Käufer gefunden haben. Die Kassen der Geschäfte klingelten.
Ganze Paletten mit Joghurt, mit H-Milch, vielleicht zehn Pakete Fischstäbchen auf einmal aus der Gefriertruhe wurden aus den Supermärkten mitgenommen. Sie schienen gleich für einen ganzen Ort einzukaufen. Oft reichte ihnen für ihren Einkauf nicht ein Einkaufswagen. Dafür stand ich nun manchmal ratlos vor teilweise leeren Regalen und die Paletten mit neuer Ware versperrten die Wege durch die Gänge. Die Angestellten des Supermarktes kamen mit dem Auspacken der Waren nicht mehr nach.
Dabei rollten unentwegt riesige Lastwagen die schmalen Straßen zur Grenze hin nach dem Osten. Was wurde da nur an Waren hinübergeschafft. Doch für die Menschen, die einen Ort im Westen erreichen konnten, war es immer noch reizvoller bei uns einzukaufen als in ihren Läden. Wie oft hörte ich, drüben sei alles viel zu teuer.
So musste ich mich an den Kampf um einen Parkplatz beim Supermarkt gewöhnen und an das Gedränge im Laden. Wie oft bekam ich jetzt nicht alles, was ich haben wollte und musste kurzfristig umplanen, was wir doch längst nicht mehr gewöhnt waren. Ja, ich erwischte mich sogar dabei, als ich endlich wieder einmal Fischstäbchen in der Gefriertruhe vorfand, nahm auch ich nicht nur eine Packung mit, sondern gleich drei. Denn wer konnte schon wissen, wann es wieder welche gab.
Irgendwann jedoch musste sich das wieder normalisieren, irgendwann musste auch der Trubel im Ort wieder abnehmen. Längst sprachen nicht mehr Fremde mit Fremden als wären sie langjährige Freunde. Es war vorbei, dass es, wie in den ersten Tagen nach der Grenzöffnung, einen aus dem Osten drängte, jemandem seine Freude darüber mitzuteilen und der aus dem Westen ihm ebenso freudig zustimmte. Im Gegenteil, jetzt konnte man bereits dies und jenes ungeduldige Wort von einem Einheimischen über diese Invasion aus dem Osten hören, wenn die Straßen wieder verstopft, die Läden überfüllt und die Regale teilweise leer waren.
*
In West-Berlin war es auch nicht anders. „Im Berufsverkehr ist kaum noch ein Durchkommen auf den Straßen. Aus dem Grunewald brauche ich jetzt am Morgen ewig lange bis ich zum Betrieb in die Stadt komme“, berichtete Helmut.
Auch Susanne machte das zu schaffen, besonders jetzt, weil sie alles zum Umzug fertig machen musste. „Zu meinen Geschäften brauche ich mich ja nicht mehr durch den Verkehr zu kämpfen“, sagte sie bitter. Die waren nun endgültig verkauft.
Mit den Mädchen hatte sie auch ihren Kummer. Christine, die Große, meuterte, sie wollte nicht in so ein Kaff ziehen und von ihrem ersten Freund getrennt werden. Daniela tat sich wie immer schwer mit Veränderungen und war von Angst vor allem Neuen beherrscht. So war es bereits gewesen, als sie in den Kindergarten und später zu einer fremden Frau in eine zeitweise Pflegestelle musste. An Susanne festgekrallt hatte sie sich geweigert, dort zu bleiben. Nur bei Margot hatte sie nie Schwierigkeiten gemacht, die schien sie mitunter sogar mehr zu akzeptieren als ihre eigene Mutter. Jetzt aber sollte sie noch ihre einzige Freundin zurücklassen. Dabei war sie sich sicher, so eine Freundin nie wieder finden zu können. Also ging sie Susanne klagend und jammernd auf die Nerven. Nur die kleine Petra war zufrieden. Sie, die gebockt und getobt hatte, als sie mit ihren drei Jahren nur begriff, dass ihr geliebter Vati allein nach Harzerode ziehen könnte, sie war wohl die Einzige, die sich auf diesen Umzug freute, weil sie damit auch in die Nähe von Julchen kam, in die sie vernarrt war.
Am liebsten hätte ich Susanne in den Arm genommen, wenn sie mir von all ihren Sorgen erzählte. Der Termin ihres Umzuges kam näher, und sie wussten noch nicht, wo sie in Harzerode wohnen würden. Schließlich kam ein Hilferuf von ihr.
„Jetzt wird es eng für uns“, berichtete sie. „Die Nachmieter drängen uns, zum abgemachten Termin auszuziehen. In Harzerode aber haben sie noch immer nicht entschieden, welches Haus sie für uns mieten wollen. Sie sagen, sie hätten drei Häuser in Aussicht, und es wäre gut, wenn wir selbst die Entscheidung treffen könnten, weil zwei davon eigentlich verkauft werden sollten und nur vorübergehend ein Mietverhältnis möglich wäre. Mit der Umzugsfirma haben wir bereits gesprochen. Unsere Sachen können bei ihnen auf dem Speicher bleiben, bis wir sie abrufen. Wo aber bleiben wir? So dachten wir, wenn du vielleicht ... aber das ist nur eine Frage ... denke nicht, dass wir das von dir erwarten ... Doch schön wäre es, wenn wir vorerst bei dir bleiben könnten, wo du doch so in der Nähe wohnst.“
Zunächst war ich sprachlos. Damit hatte ich nicht gerechnet.
„Du kannst mir ehrlich sagen, wenn dir das zu viel wird“, beeilte Susanne sich, mir zu versichern. Doch es klang beklommen.
Da kam ich zu mir. Natürlich, das war keine Frage. Nie würde ich Susanne abweisen. „Nein, nein! Das wird gehen“, beeilte ich mich zu versichern. „Ich überlegte nur einen Moment, wie ich euch fünf hier unterbringen kann.“
Ich glaubte, den befreiten Atemzug zu hören, als ihr ein Stein vom Herzen fiel, und sie sofort erklärte: „Mach dir um Betten keine Sorgen. Wenn du uns nur zwei Zimmer zur Verfügung stellen kannst. Wir haben bereits alles so geregelt, dass ein Kleintransporter die wichtigsten Sachen von uns zu dir bringt. Dabei sind auch Matratzen für die Kinder. Für uns, dachte ich, geht vielleicht die alte Doppelbettcouch von Euch, die du noch immer hast.“
Verblüfft schwieg ich einen Moment. Dann musste ich lachen. „Ihr habt also schon alles überlegt und geregelt. Dann war das wohl nur noch eine Frage pro forma?“
Da lachte auch Susanne befreit. „Ich konnte mir tatsächlich nicht vorstellen, dass du es uns abschlagen würdest.“
Erst eine Weile nach diesem Telefongespräch fragte ich mich: Und wo bleibe ich in dieser Zeit? So groß war mein Haus ja nicht. Im Erdgeschoss war neben einem kleinen Duschbad die geräumige Küche, in der es sogar eine Essecke gab. Dann waren da noch das Wohnzimmer mit den großen Glastüren und der Terrasse davor sowie daneben, durch breite Schiebetüren miteinander verbunden, ein geräumiges Zimmer mit Blick zum Garten. Früher, als Konrad noch lebte, hatten wir darin unser Schlafzimmer, damit er nicht jeden Tag die Treppen nach oben laufen musste. Nach seinem Tod hatte ich aus diesem Zimmer mein Arbeitszimmer gemacht. Hier stand jetzt mein Schreibtisch, hier saß ich und ließ meiner Fantasie freien Lauf, wenn ich meine Geschichten schrieb. Hier hatte ich auch Platz für einen Computer gefunden. Mein Schlafzimmer war längst wieder oben, wo es noch zwei Zimmer, eine Kammer und ein Bad gab.
Ich könnte mein Bett in mein Arbeitszimmer herunterholen und ihnen die beiden Räume oben überlassen, so überlegte ich. Unsere alte Doppelbettcouch stand ohnehin in einem der oberen Zimmer. Eigentlich hätten wir sie längst nicht mehr gebraucht. Doch trennen hatten wir uns von ihr auch nicht können. Mehrmals neu aufgepolstert wurde sie sogar. Sie war die erste mühsam ersparte Anschaffung in unserer Ehe gewesen, als wir noch zur Untermiete in einem Zimmer bei der Witwe Willinger wohnten, ein besonderes Erinnerungsstück eben. Nun war es gut, dass es sie noch gab. Doch damit war es nicht getan. Ich musste auch Platz für ihre Sachen schaffen. Das hieß, meine persönlichen Dinge mussten aus den Zimmern raus und in die Kammer, die sonst nie richtig genutzt wurde. Mit Julchen würde es keine Schwierigkeiten geben, sie war stets zufrieden, wenn sich ihr Körbchen in meiner Nähe befand. Nachts stand es an meinem Bett und am Tage meistens neben meinem Schreibtisch. Ja, so würde es gehen. dann hätten sie oben die Etage für sich und ich könnte hier unten vielleicht weiterhin ungestört arbeiten. So hoffte ich!
Читать дальше