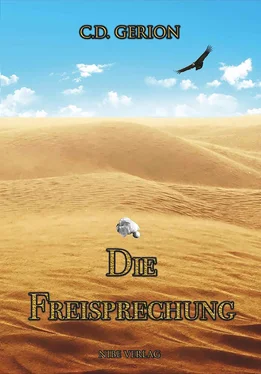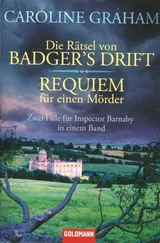Endlich legte Martina ihr Buch zur Seite und richtete sich auf.
„Oh Gott, ja. Wenn der Botschafter dich nicht vorzeitig aus dem Urlaub zurückgerufen hätte, wären wir an dem Abend womöglich genau zu der Zeit an der Stelle vorbeigelaufen, wo es passiert ist. Unser Lieblingsrestaurant lag ja genau gegenüber.“
„Oder denk an Ruanda. All das, was uns dieser Jesuitenpriester mit der großen Sonnenbrille erzählt hat, den wir damals in Kigali kennengelernt haben.“
„Das Schlimmste, was ich je gehört habe!“, sagte Martina. Jetzt hatte ich ihre ganze Aufmerksamkeit.
Es war im Mai 1995 gewesen. Geberkonferenz in Kigali zur Sicherung der Finanzierung des geplanten großen Ruanda-Völkermordtribunals. Damit oder überhaupt mit Afrika hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Martina und ich hatten uns damals auf unsere unmittelbar bevorstehende Versetzung nach Tokyo gefreut. In meinem bisherigen Referat hatte ich mich bereits verabschiedet. Unser Umzugsgut war eingepackt. Wir waren nur noch in Bonn, um letzte Termine wahrzunehmen und restliche Einkäufe zu erledigen. Da kam der Anruf aus der Personalabteilung. Der Kollege aus der Zentrale, der Deutschland auf der Konferenz vertreten sollte, sei kurzfristig krank geworden. Die Botschaft Kigali könne niemanden abstellen. Die seien ja alle mit den zahllosen neuen Hilfsprojekten und den damit verbundenen Delegationen und Koordinierungskonferenzen total überlastet. Ich sei doch im Moment gerade frei. Dabei hatte ich in dem Moment alles Mögliche im Kopf, nur keinen Ausflug in die Hauptstadt des ‚christlichsten Landes in Afrika‘. Aber das war ein Angebot von der Sorte, die man nicht ablehnen konnte. Ich freute mich nur, dass Martina bereit war mitzukommen. Sie hatte keine Lust, in der leergeräumten Wohnung auf meine Rückkehr zu warten oder zu meinen Eltern zu fahren, wo wir die Kinder schon ‚geparkt‘ hatten, um ihnen das Umzugschaos zu ersparen. Und ein wenig machte sie sich wohl auch Sorgen, mich da alleine runter zu lassen. Nach all den Horrormeldungen über das, was sich dort kurz zuvor abgespielt hatte.
Es muss gegen Ende unseres drei- oder viertägigen Aufenthalts gewesen sein. Der Mann mit der großen verspiegelten Sonnenbrille war uns schon vorher mehrmals aufgefallen. Nicht nur wegen der Brille, die er selbst in der nicht gerade grell erleuchteten Eingangshalle unseres Hotels nie abnahm. Er hatte sowas Asketisches. Und dann diese auffallend hohe Stirn. Ungewöhnlich war auch gewesen, dass er häufig in der Lobby zu arbeiten schien. Man sah ihn eigentlich immer nur in einem der Sessel in der Sitzecke im hintersten Winkel der Halle, wo er entweder Papiere sortierte und irgendwas aufschrieb. Als ich an jenem Nachmittag von meiner Konferenz zurück ins Hotel kam, sah ich Martina dort bei ihm sitzen. Sie winkte mich herüber und stellte uns einander vor. Er war Jesuitenpriester und arbeitete für seinen Orden in der Flüchtlingshilfe in Addis Abeba. Nach Ruanda war er mit dem Auftrag herübergekommen, zu erkunden, ob es hier vielleicht Ansätze für ein Engagement des ‚Jesuit Refugee Service‘ gab. Martina war mit ihm ins Gespräch gekommen, als sie zufällig mitbekommen hatte, dass er Deutsch sprach.
Der Mann interessierte sich natürlich auch für meine Geberkonferenz und was die aus meiner Sicht ergeben würde.
„Dieses Land wird jetzt zugeschüttet mit Geld“, antwortete ich ihm auf seine Frage, „Allein schon, weil alle ein schlechtes Gewissen haben.“
„Mit Recht“, antwortete er mit Nachdruck.
Er erzählte uns, dass sich auch die deutsche Botschaft nicht gerade mit Ruhm bekleckert hätte. Ein Oberst der deutschen Bundeswehr-Beratergruppe, die damals vor Ort war, hätte dem Botschafter nur wenige Tage vor Beginn des großen Mordens von regelrechten Massakertrainings regierungsnaher Milizen berichtet. Es werde zu einem Massenmord kommen. Der Botschafter hätte das süffisant als ‚Panikmache verrückter Militärs‘ bezeichnet. Die dächten eben immer nur an Leichen. Ein Teilnehmer einer ‚Herrenrunde‘ in der Residenz hatte das unserem Priester gesteckt. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, denn dazu konnte ich natürlich nichts sagen. Wir merkten aber schnell, dass es unserem Mann sowieso um etwas ganz anderes ging. Er war bei seiner Erkundungsmission kreuz und quer durch das Land überall auf wahre Horrorgeschichten gestoßen. Schließlich hatte er angefangen, sich Notizen zu machen und systematisch Zeugenaussagen zu sammeln. Das war es also, was er dort in seiner Ecke in der Hotellobby („um dabei unter Menschen zu sein“, wie er uns am Ende anvertraut hat) die ganze Zeit tat: Aus all dem gesammelten Material eine Dokumentation zusammenzustellen, die er dann nachts in seinem Hotelzimmer oben ins Reine tippte. Er war offensichtlich froh, jetzt mit uns auch darüber reden zu können. Es war kaum zu ertragen. Selbst wenn man, wie wir, schon einiges über die monatelange mörderische Raserei in Ruanda gehört hatte. Er kannte Details.
„Jetzt weiß ich wieder: Hyacinthe…“ Martina war inzwischen aufgestanden und starrte hinaus in den undurchdringlichen Nebel.
„Wovon sprichst du?“
„Das Mädchen. Sie hieß so. Sie haben sie in Stücke gehackt, nachdem sie mit ihr fertig waren.“ Martina drehte sich zu mir um: „Weißt du das etwa nicht mehr? Dieser Priester hatte sich sogar ein eigenes Liebesnest eingerichtet. Im Mille Collines, unserem Hotel. Das lag so praktisch gleich um die Ecke von seiner Kirche.“
Endlich kapierte ich, was sie meinte. Das war einer der von unserem Jesuitenfreund dokumentierten ‚Fälle‘ gewesen. In der besagten Kirche hatten Hunderte von Flüchtlingen Schutz gesucht. Der dortige Priester war in Begleitung von Männern einer der Mördermilizen unter ihnen herumspaziert und hatte Tutsi, die er erkannte, laut als Kakerlaken bezeichnet und sie damit zum Abschlachten freigegeben. Eine Reihe besonders attraktiver junger Tutsi-Mädchen und Frauen hatte er dagegen ‚gerettet‘ – gegen das Versprechen, dass sie mit ihm schliefen. Dafür hatte unser Jesuit gleich ein halbes Dutzend Zeugen aufgetan. Darunter eine Mutter, die ihm versichert hatte, dass ihre sechzehnjährige Tochter dem Morden zum Opfer gefallen war, nachdem sie sich geweigert hatte, diesem Priester zu Willen zu sein. Daran, dass das Mädchen Hyacinthe hieß, hatte ich mich aber nun wirklich nicht mehr erinnert.
Dass in Ruanda in dreieinhalb Monaten fast eine Million Menschen hingeschlachtet worden waren – Christen von Christen im christlichsten Land Afrikas, das war für unseren Jesuiten eine Chronik himmelschreienden Versagens der Kirche. Allein der bittere Ton seiner spröden und manchmal brechenden Stimme hatte uns verraten, dass sich hinter den verspiegelten Gläsern seiner großen Sonnenbrille ein Mann verbarg, der aus dem Gleichgewicht geraten war und verzweifelt nach Halt suchte. Wir hatten an jenem Tag bis spät abends zusammengesessen. Er hatte uns auch erklärt, warum ihm seine Dokumentation so wichtig war. Er wollte, dass sich seine Kirche ihrer Verantwortung für das Geschehene stellte. Andernfalls hätte sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt und den Glauben verraten.
Martina war in ihrer Rückerinnerung offenbar gerade an der gleichen Stelle angelangt.
„Er ist ja so weit gegangen, die Frage zu stellen, ob jemand überhaupt noch Priester sein könne, wenn er Zeuge solch ungeheuerlicher Taten von Menschen geworden sei, die sich selbst als Christen sähen.“
„Kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern“, sagte ich. „Ich weiß nur noch, dass er diesen berühmten Priester erwähnt hat, der zur Zeit der spanischen Eroberung Lateinamerikas die Grausamkeit der ‚christlichen Conquista‘ dokumentiert hat, und dass der trotzdem Priester geblieben wäre. Und er hat was von den Schutzgebieten erzählt, die Missionare des Jesuitenordens damals gegründet haben, um die Indios vor Versklavung zu schützen, und wie erfolgreich sie dort mit ihren Schützlingen gemeinsam blühende Gemeinwesen aufgebaut haben.“
Читать дальше