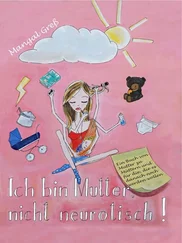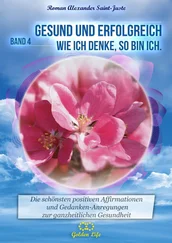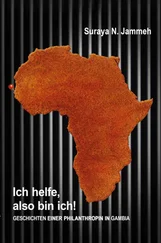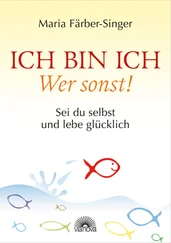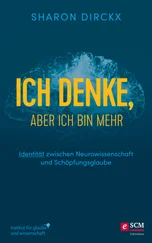Selbst unseren Körper können wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Vielmehr wird das Empfinden unserer körperlichen Identität in verschiedenen Arealen des Gehirns erzeugt. Ein berühmtes Beispiel für die fehlerhafte Repräsentation des Körpers sind die sogenannten Phantomschmerzen. Menschen, denen Gliedmaßen amputiert wurden, empfinden nicht selten Schmerzen in eben den Körperteilen, die sie gar nicht mehr haben. Für das Gefühl "mein Arm" oder "mein Bein" ist die tatsächliche Existenz des entsprechenden Körperteils offenbar gar nicht notwendig. Auch der umgekehrte Fall ist in der Neuromedizin bekannt: Patienten können das Empfinden haben bestimmte Körperteile seien nicht Teil ihrer selbst. Der eigene Arm oder das eigene Bein werden als störender Fremdkörper empfunden. Für unser Gefühl von Identität ist der Körper jedoch sehr wichtig: Doch neurologische Defekte wie die beschriebenen zeigen, wie wenig stabil selbst dieser scheinbar noch greifbare und klare Bezug von Körper und "Ich" ist. Denn theoretisch kann das Gehirn ein Körpergefühl auch ohne vorhandenen Körper erzeugen und umgekehrt auch Körperteile steuern und am Leben erhalten, ohne dass wir sie als Teil unseres Selbst wahrnehmen. Deine Träume zeigen, wie groß die schöpferischen Fähigkeiten des Gehirns sind, auch in Hinblick auf die Identität. In deinen Träumen kannst du dich als andere Personen erleben, als körperlos oder ausgestattet mit körperlichen Merkmalen, die gänzlich verschieden von den tatsächlichen sein können. Das Gefühl eines "Ich" kann das Gehirn solchen geträumten Figuren ohne weiteres überstülpen oder entziehen.
Inwieweit ist die Überzeugung für unserer Identität mit deinem Körper verbunden? Dein Körper ist das wichtigste und unmittelbarste Instrument deiner Handlungen. Doch selbst in dieser Funktion lässt sich das Verhältnis von Körper und "Ich" verschieben. Das zeigen etwa Untersuchungen bei Blinden, die gewohnheitsmäßig einen Blindenstock zur Orientierung verwenden: Nach einer gewissen Zeit wird der Stock häufig als eine Art Körperteil empfunden. Auch psychologisch lässt sich der Begriff des "Ich" nicht eindeutig klären. Einig sind sich die meisten Wissenschaftler, dass das "Ich" keine konstante Größe ist, sondern aus verschiedenen Faktoren besteht, die sich in ihrer Zusammensetzung und Gewichtung auch verändern und unterscheiden können. Eine allgemeine Definition des Begriffs aber gibt es nicht. Was erstaunlich scheint, wenn man bedenkt, wie präsent uns das Gefühl der eigenen Identität ist.
Ramana Maharshi: „Der Ich-Gedanke ist eine gewohnheitsmäßig affirmierte falsche Annahme, die selbst keinerlei Wirklichkeit besitzt. Er kann nur durch Identifizierungmit einem Objektin Erscheinung treten. Wenn Gedanken auftauchen, hält sich der Ich-Gedanke für ihren Verursacher — „Ich denke“, „Ich fühle“, „Ich wünsche“, „Ich handle“ —, aber es gibt keinen separaten Ich-Gedanken, der unabhängig von dem Objekt existiert, mit dem er sich identifiziert. Er scheint nur deshalb als Wirklichkeit zu existieren, weil der Fluss ständiger Identifizierungenunaufhörlich anhält. Fast alle diese Identifizierungenkönnen zurückgeführt werden auf die Annahme, dass das „Ich“ auf den Körper begrenzt ist. Diese „Ich bin der Körper-Vorstellung“ ist die Hauptursache aller daraus folgenden falschen Identifizierungen, und ihre Auflösung ist das wichtigste Ziel der Selbstergründung .Da der individuelle Ich-Gedanke ohne ein Objekt nicht existieren kann, muss die Aufmerksamkeit so intensiv auf das subjektive Empfinden von „Ich“ oder „Ich bin“ gerichtet werden, dass die Gedanken „Ich bin dies“ oder „Ich bin das“ gar nicht erst aufsteigen.“
Die meisten psychisch gesunden Menschen erleben das "Ich" als die Steuerzentrale der eigenen Person. Doch die Hirnforschung hat eine solche Institution in den Hirnarealen nicht ausmachen können und es gilt als höchstwahrscheinlich, dass es keinen fixen Ich-Punkt im Gehirn gibt. Das Ich-Bewusstsein entsteht vermutlich im Großhirn, aber als dynamischer Prozess und nicht in Form eines starren Musters. Untersuchungen in der Hirnforschung haben kein Indiz dafür gefunden, dass dieses "Ich" anderen Hirnfunktionen vorgeschaltet ist. Dein alltägliches Gefühl "Ich habe ein Gehirn, das ich benutze" kann durchaus in das Gegenteil umformuliert werden: Das Gehirn erzeugt ein "Ich", weil es eine bestimmte Funktion damit verknüpft. Manche Hirnforscher sind der Meinung, dass das Gehirn ein "Ich" entwickelt hat, weil sich dadurch die Überlebensfähigkeit des Menschen enorm verbessern konnte: Das "Ich" wird zu einer Unterfunktion eines höchst komplexen Systems, des Gehirns eben. Die Hirnforschung hat auch gezeigt, dass unser „Selbst“ nichts anderes ist als eine Ansammlung von Aufmerksamkeit. Wahrnehmungen werden zu einem in sich stimmigen System verschmolzen, das wir dann Wirklichkeit nennen. Daraus folgt allerdings, dass Wirklichkeit nichts anderes ist als Aufmerksamkeit. Nur das, was wir wahrnehmen, existiert für uns. Oder anders herum: Wir erschaffen mit unserer Wahrnehmung unsere eigene Welt. Das Gefühl des ‚Ich‘, einer Einheit und Kontinuität der Persönlichkeit, des Gefühls, dasselbe ‚Selbst‘ in Zeit, Ort und durch alle Bewusstseinsstufen hindurch zu sein, kann als etwas verstanden werden, das nicht der Persönlichkeit angeboren ist, sondern das sich im Laufe der Entwicklung aus unserer Erfahrung von Objekten und den Interaktionen mit ihnen herausbildet. Mit anderen Worten, das Selbst ist buchstäblich konstruiert aus unseren Erfahrungen mit der Welt der Objekte. Das zeigt sich dramatisch bei einer multiplen oder dissoziativen Identitätsstörung. Solche Menschen weisen zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten auf, die abwechselnd, aber nie gemeinsam sichtbar sind und getrennte Gedanken, Erinnerungen, Verhaltensweisen und Gefühle äußern. Der Wechsel von einer Person zur anderen wird nicht einmal wahrgenommen. Dieses ‚Selbst‘, das wir als unser ‚Ich‘ verstehen und das wir als so gegenwärtig und real empfinden, ist eigentlich ein verinnerlichtes Bild, ein Selbstkonstrukt. Da es zusätzlich immer auch unbewusste Bedürfnisse gibt, die uns beeinflussen ist es schwierig sich vollständig davon zu befreien. Das wohl bekannteste Beispiel sind die nach ihrem Entdecker benannten „Pawlowschen Hunde“, die nach einigen Wiederholungen Speichelfluss bei einem Glockenton zeigen, obwohl kein Futter gegeben wurde. Der vorher neutrale Reiz (=Glockenton) wird durch Assoziationzu einem bedingten Reiz, der alleine fast dieselbe Reaktion (=Speichelfluss) auslösen kann, wie der unbedingte Reiz (=Futter), mit dem er gekoppelt wurde. In vergleichbarer Weise legen wir uns Menschen sowohl unbewusst wie bewusst immer mehr auf ein uns eigens Lern- und Verhaltens – Repertoire fest, man spricht in diesem Zusammenhang auch von Konditionierung. In der ernüchternden Konsequenz heißt das jedoch: Ich bin, was ich denke. Ich bin der, dem ich meine Aufmerksamkeit schenke. Das gilt für das Gehirn, aber genauso für die körperliche Ebene, also für unser „Gesamtsystem.“ Das ist der Grund, warum in allen traditionellen und zeitgenössischen Meditationsschulen der Achtsamkeit eine so zentrale Bedeutung beigemessen wird. Hier kann man praktisch erfahren, dass das Ego ein verzerrender Mechanismus ist und die Wirklichkeit - die äußere wie auch die innere – BEWUSSTSEIN ist.
Nach Thomas Metzinger ist unser Gehirn ein großes Zusammenwirken von Nervenzellen, die das Erlebnis erzeugen, in einer Welt und in einer Zeit zu sein, sich als ein Selbst von der Welt abzugrenzen und sich als Fühlender, Denkender und Handelnder wahrzunehmen, d.h. als ein Ich. Das Gehirn wäre damit ein biologisch-physikalischer Computer, das Ich eine Illusion und Projektion davon. Nach seiner Vorstellung ist das bewusste Selbst nicht einfach da, es wird im Gehirn konstruiert. Nach diesem Modell lässt sich das Ich-Gefühl dadurch erklären, dass das Gehirn ein Modell des eigenen Organismus erzeugt. Nach seinem Modell lässt sich das Gehirn mit einem Flugsimulator vergleichen: „Genau wie ein Flugsimulator aktualisiert es fortlaufend ein inneres Modell der äußeren Wirklichkeit, indem es einen kontinuierlichen Strom von Input verwendet, der durch die Sinnesorgane geliefert wird, und vergangene Erfahrungen als Filter benutzt…dabei ist das Gehirn nicht der Pilot…der Pilot wird in eine virtuelle Welt hineingeboren, und zwar ohne jede Möglichkeit, diese Tatsache zu entdecken. Der Pilot ist das Ego. Der totale Flugsimulator erzeugt einen Ego-Tunnel, aus dem es für ihn aber kein Entrinnen gibt…das Ego ist ein besonderer Teil dieser virtuellen Realität. Indem es ein inneres Bild des Organismus als Ganzem erzeugt, erlaubt es dem Organismus sich seine eigene Hardware anzueignen…Bewusstsein gibt uns die Flexibilität, und globale Kontrolle gibt und das Ego.“
Читать дальше