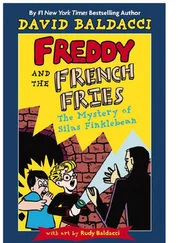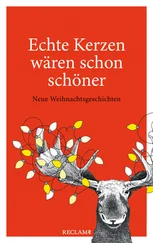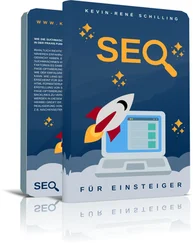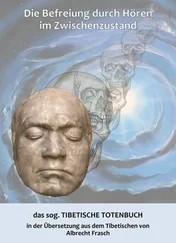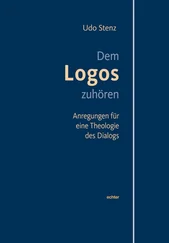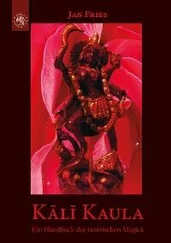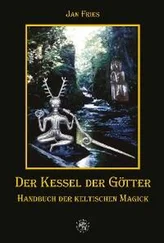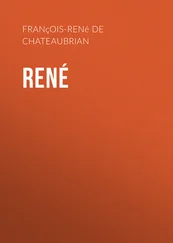Es war, wie wir wissen, die Schule von Koufa mit ihrer Ablehnung der uniformen Motivierungen und ihrem Hang zur Diversität (Rechtfertigung des Individuellen, der Ausnahme, des Unikats, kurz: dessen was einmal "Renaissance-Mensch" genannt werden sollte), die sich nicht durchgesetzt hat.
Hier das – unübersetzte weil oben ja ausreichend zusammengefasste – Originalzitat aus "Histoire de la philosophie islamique I", Henri Corbin (idées nrf, Paris 1964) S. 203/4:
"Pour l'école de Koufa, la tradition, avec toute sa richesse et sa diversité foisonnante, vaut comme la première et la principale source de la grammaire. L'école admet aussi la loi d'analogie. C'est pourquoi l'on a pu dire que, comparé au système rigoureux de l'école de Basra, celui des grammairiens de Koufa n'en était pas un. C'est plutôt une somme de décisions particulières, prononcées devant chaque cas, parce que chaque cas devient un cas d'espèce. Il y a simultanément l'horreur des lois générales, des motivations uniformes, et le goût de la diversité justifiant l'individuel, l'exceptionnel, la forme unique.
Gotthold Weil (...) proposait de comparer l'opposition entre les écoles de Basra et de Koufa avec l'opposition entre l'école d'Alexandrie et celle de Pergame, la lutte entre les 'analogistes' et les 'anomalistes'. La mise en parallèle ne vise, il est vrai, que les attitudes d'esprit, car le matériel linguistique diffère foncièrement de part et d'autre. En outre, la lutte entre les grammairiens grecs était une affaire se passant entre savants.
En Islam, l'enjeu de la lutte était grave; non seulement elle affectait les décisions du droit, de la science canonique, mais en pouvait dépendre l'interprétation d'un passage du Qorân, d'une tradition religieuse. On vient de marquer le lien entre l'esprit de l'école de Koufa et un certain type de science shî'ite; soulignons encore, comme nous l'avons déjà fait, l'affinité avec un type de science stoïcienne comme 'herméneutique de l'individuel'.
Que l'esprit de l'école de Basra ait finalement prévalu, c'est le symptôme de quelque chose qui dépasse de beaucouple simple domaine de la philosophie du langage."
Noch fataler aber war das seit jeher und auch heute noch absolut (auβer im soeben "zukunftsträchtiger" genannten Shi'ismus...) gültige islamische Bilderverbot viii.
Wenn man Ernst Peter Fischers in "Eurèka!" (Schuyt & Co Uitgevers b.v., Haarlem 2002; hier aus dem NL rückübersetzt ins Deutsche) gemachte Randbemerkung zu Einstein liest, dann hat man auch sofort begriffen warum: " In diesem Zusammenhang ist der Schlüsselbegriff das Wort 'Bild', und zwar nicht als 'picture' aufzufassen wie in der Photographie, sondern als 'image' wie in der Malerei. Unser Denken endet mit Bildern und beginnt mit dem Betrachten von Malereien, wie die Psychologie weiβ. Anhand des Beispiels ‚Einstein' kann man das verdeutlichen. Einstein hat einmal in einem Gespräch mit einem Psychologen erzählt, dass sein wissenschaftliches Denken beginnt mit Bildern, die in ihm andere Bilder hervorrufen und einen Strom entstehen lassen den er dann mühsam umsetzen müsse in Worte und Formeln, um sie überhaupt mitteilen zu können. (...) Der Beitrag von Bildern am Entstehen des Wissens ist schon bei Einsteins berühmtem Vorgänger Kepler zu finden (…). Was Kepler sagt, können wir auch anders formulieren, nämlich dass wir erst dann etwas über die Welt wissen wenn wir sie uns durch Bilder (also immer im Sinne von 'Malereien') zu eigen gemacht haben".
Dieser islamische allgemeine Bildermangel hat denn auch sehr weitreichende Folgen. Wie Blumenberg schreibt: "Nicht nur die Sprache denkt uns vor und steht uns bei unserer Weltsicht gleichsam im Rücken; noch zwingender sind wir durch Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, 'kanalisiert' in dem, was überhaupt sich uns zu zeigen vermag und was wir in Erfahrung bringen können."
Wie man sieht geht's hier um ganz andere Dinge als um die – vorsichtig ausgedrückt: blöde – Frage ob wir Katholiken "Maria und die Heiligen(bilder) anbeten" – tun wir nicht; oder ob wir sie nur bitten, für uns beim Allmächtigen Fürbitte einzulegen – tun wir.
Und zwar aus einem von Ernst Wiechert sehr schön formulierten Grund: "Sehen Sie, manchmal in diesen Jahren habe ich gezweifelt, an Gott, ja, das habe ich getan. Aber an den Heiligen nicht. Von Kind auf war ich bei ihnen, das ist in unserem Glauben so, näher bei ihnen mitunter als bei Gott. Er ist so weit, so schrecklich weit. Aber sie sind nahe, an unserer Seite, denn sie haben auch gelitten, ebenso wie wir, mehr noch." ( Das einfache Leben , Ullstein Ffm/Berlin 1995, S. 51)
Noch schöner ist's – irgendwie selbstverständlich , ja gewiβ doch – mit Maria. Leider kann hier nur sehr kurz angedeutet werden welchen Dank sämtliche Machos, jedesmal wenn sie von "Liebe" faseln, der Gottesmutter schulden: Mit einem dezenten Hinweis auf Denis de Rougemont, der in "L'amour et l'Occident" (éditions Plon, Paris 1939) herausgearbeitet hat dass das, was wir heute "Liebe" nennen, so recht eigentlich erst eine mittelalterliche Schöpfung ist – und zwar in erster Instanz und unter arabischem bezw. andalusischem Einfluβ, eine Schöpfung der Troubadours. Deren "höfische" Minne wäre jedoch ohne die damals – in zweiter Instanz – gerade "epidemisch" werdende Maria-Verehrung nur episodisch geblieben. Besagte Madonna-Verehrung ist es also die, laut de Rougemont, erst unseren Kulturkreis für die "romantische" Liebe überhaupt aufnahmefähig gemacht hat.
Mit anderen Worten: als Tamerlan kam, konnte er auβer Hunderttausenden von Menschenleben schon nichts wirklich Wichtiges mehr zerstören. Denn auch eine vierte mögliche Entwicklungslinie war ja schon nicht so konsequent wie bei uns weiterverfolgt worden; es ging da hauptsächlich um logische Probleme betreffs "Gottes Allmacht", die aber in Ermangelung jeglicher "Erbsünde"- und "Inkarnations ix "-Problematik leider nicht so auf die Spitze getrieben wurden wie bei uns [ganz kurz: Tempier's Edikt von 1277 ("Quod prima causa posset producere effectum sibi aequalem nisi temperaret potentiam suam", Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 26), der Occamismus, die "platonische Reaktion" ab Petrarca d.h. florentinische Renaissance undsoweiter ]; all dies natürlich immer in der bekannten Böhmeschen "objektiven Dialektik" die auch vor Scheiterhaufen nicht zurückschreckte, wie wir alle wissen. Es soll denn auch keine wie immer geartete Verniedlichung der damaligen Gewissenszwänge mit all ihren Folgeerscheinungen versucht bezw. toleriert werden, sondern hier geht es um "Gesetzmäβigkeiten", soweit sie eben halbwegs erkennbar sind. [Diese Gesetzmäβigkeiten sind es denn auch die einzig und allein den Anspruch einer bestimmten Kultur x stützen könn(t)en, wo nicht "hochwertiger" zu sein dann doch "geschichtlich relevanter" als eine andere (oder: alle anderen) xi].
Man sieht, dass diese Probleme an denen unser Mittelalter schlieβlich zerbrochen, aber schöpferisch zerbrochen ist, zwar ansatzweise im Islam gleichfalls gestellt, jedoch aus "dogmatischen" internen Gründen so oder so nicht bis zum bitteren d.h. "objektiv-dialektisch äuβerst vorteilhaften" Ende ausgefochten werden konnten. Was die letztlich wohl einzig mögliche Erklärung dafür ist, dass trotz besserer Startposition der Islam schlieβlich nicht "der" Entwicklungsträger werden konnte. Die 40.000 Toten unter Selim oder die Millionen unter Tamerlan mögen da nur noch unter "grausige Zugabe" firmieren. Wir modernen Europäer haben jedoch nicht den geringsten Grund, angesichts dieser Zahlen "Barbarei!" zu schreien, mussten doch (immer "schön objektiv-dialektisch") erst einmal nicht 4- oder 40.000, sondern, in zwei Weltkriegen, weit über 70 Millionen Menschen geschlachtet werden bevor unsere heutige Europäische Union überhaupt "denkbar" werden konnte xii.
Читать дальше