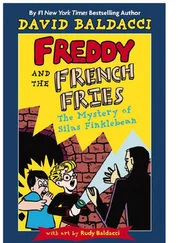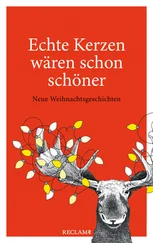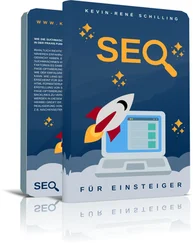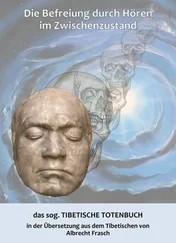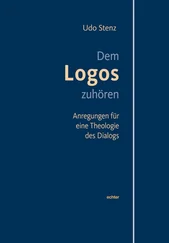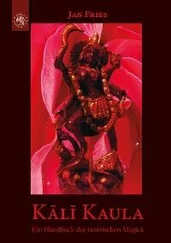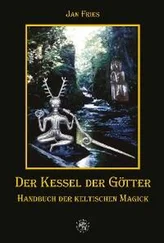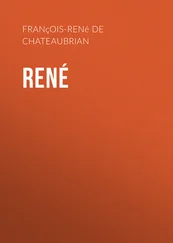"Immanente Teleologie" auch bei J. Burckhardt: Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 und der nachfolgenden Kommune reiste er nach Rom und genoβ dort, wie er seinem Kollegen Nietzsche schrieb, die Fülle herrlicher Kunstwerke mit dem ausdrücklich vermerkten Hintergedanken, eine höhere Macht könnte ihn, Burckhardt, nach Rom verschlagen oder beordert haben um den Vatikan zu photographieren bevor etwa ein schauderhaftes Schicksal darüber hinweggehe. Denn seit dieser Pariser Kommune sei überall in Europa alles möglich. Weiter, schrieb er, überkomme ihn manchmal ein Grauen, die Zustände Europas könnten sozusagen über Nacht in eine Art "Schnellfäule" umschlagen. "Und wer weiβ, wie diese Zeiten erst noch werden wollen".
Dies verräterische – bei einem präzisen Stylisten wie Burckhardt auf jeden Fall verräterische weil sehr bewuβt geschriebene – w ollen deutet hin auf etwas das der oben genannten "immanenten Teleologie des europäischen Menschentums" zumindest ähnelt, und kann auch mit Max Schelers "intentionalem Fühlen" in Verbindung gebracht werden sowie mit jenem "unterirdischen Wühler", der etwas später bei Kafka vorkommt. Es gibt denn auch tatsächlich, wie die Kenner jener Epoche wissen, ein entsprechendes "Generationsgefühl", worüber z.B. auch Ernst Wiechert ausführlich geschrieben hat v. Und wobei es demzufolge um nichts weniger als um einen Gedankenstrang geht, der eine wie immer geartete aber jedenfalls auch nicht allzu vage "menschheitlich-geistige Intentionalität " zur Voraussetzung hat, und dem also einige der gröβten damals lebenden Geister ungefähr gleichzeitig nachhingen.
Dass all diese, zwangsläufig unausgegorenen d.h. "unkritischen" Generationsgefühle alsbald auf die blutigste Art bestätigt werden sollten und zwar gleich doppelt, braucht hier nicht noch extra betont zu werden.
Die weiter oben herausgehobenen Termini 'anthropogenetischer Prozeβ' und 'immanente Tendenz' scheinen jedenfalls, rein philosophisch gesehen, unanfechtbar.
Die Weltgeschichte nun, also das laut Leibniz bestmögliche viUmsetzen der o.g. immanenten Tendenz , ist "objektiv dialektisch"; wie Jakob Böhme ganz richtig erkannte, kann der jovialische Schein des Lichts ohne Dunkelheit noch nicht mal gedacht werden. Und über Böhme schreibt also Ernst Bloch (in: Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte , Suhrkamp, Ffm 1977, S. 228 ff): " ...im Volk lief dagegen mit völliger Ungleichzeitigkeit etwas weiter, was viel älter war, eben die alte manichäische Lehre, durch Traktätchen verbreitet in finsteren Kneipen, in Schmieden, in Spinnstuben, wo es sonderbare Hergereiste gab, die etwas erzählten, was ganz anders klang als das, was der Herr Pfarrer in der Kirche predigte. Das lebte in den versponnenen Menschen und den versponnenen Winkeln und Konventikeln weiter, ging von Mund zu Mund, war wohl auch gefährlich, gesagt zu werden. (...) Diese Welt war auch da, und sie ist den bürgerlichen Literaturhistorikern und Philosophiehistorikern völlig entgangen. Und plötzlich tauchte im 17. Jahrhundert aus dieser Welt ein Denker auf, ein bedeutender Philosoph, der nichts mit der scholastischen Bildung zu tun hatte, der ein Handwerker war (...) mit viel trüber Mystik, aber auch mit der tiefsinnigsten Form von Dialektik, die es seit Heraklit gab".
Wie tiefsinnig, das zeigt Leibnizens Pech – sogar Voltaire hat damals "nix kapiert".
Man weiβ, dass Leibnizens "Optimismus" das Pech hatte, dem Lissaboner Erdbeben von 1755 nicht gewachsen zu sein, weil die damalige Wissenschaft ja nicht so weit wie die heutige war und das alte augustinische "unde malum?" ["woher (kommt) das Böse?"] deshalb eine Virulenz hatte bezw. behielt wie sie jedoch im Lichte neuerer Forschung nicht mehr gegeben erscheint: der Zusammenhang zwischen Tektonik (Erdbeben), Gebirgsformierung, Klima (Wind, Regen), Erosion und Leben ist ja derart, dass das Leben ohne die genannten Phänomene nicht möglich bezw. nicht entstanden wäre. Noch grundlegender, nämlich von der Astrophysik her, wird dieser Sachverhalt in der nl. Zeitschrift Natuurwetenschap en techniek (NWT) 4/2003 beleuchtet: "Überdies entstehen Gammablitze während jener (Stern-)Explosionen, die Hoflieferanten sind von allen Elementen schwerer als Helium. Erst gegen Ende ihres Lebens, wenn der Wasserstoff verbraucht ist, formen Sterne schwerere Elemente. Die verbreiten sich durchs Weltall nachdem der Stern stirbt. Ohne kosmische Superexplosionen gäbe es keinen Sauerstoff, Kohlenstoff, Calcium und Eisen. Ohne kosmische Superexplosionen kein Leben."
Die Böhme'sche "objektive Dialektik" – ohne Dunkelheit ist Licht noch nicht einmal denkbar – scheint also konstitutiv für die gesamte Schöpfung zu sein.
Nun hat aber die dem alten augustinischen "unde malum?" eigene Virulenz ja nicht nur Leibniz zu seinen Essais de théodicée veranlaβt, sondern auch Bossuet nicht losgelassen.
"ESSAIS DE THEODICEE – Sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal", chronologie et introduction par J. Brunschwig, Garnier-Flammarion, Paris 1969. Hierzu Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie , suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1301, Ffm 1998, S. 129: "In der 'Théodicée' setzt sich Leibniz mit der Auffassung Bayles auseinander, dass es Vernunfteinwände gegen die Religion gebe, die nicht oder zumindest noch nicht entkräftet werden könnten; Leibniz meint (§ 27), dass die aristotelische Logik völlig ausreiche, um jede solche Argumentation jederzeit zu bewältigen, sofern sie wirklich rein deduktiv-rational sei. Anders sei es bei den Einwänden, die auf Wahrscheinlichkeit beruhen, car l'art de juger des raisons vraisemblables n'est pas encor bien établi, de sorte que nostre Logique à cet égard est encor très imparfaite, et que nous n'en avons presque jusqu'icy que l'art de juger des demonstrations (§ 28). Aber dieser mangelhafte Zustand der Logik falle bei der Verteidigung der Religion nicht ins Gewicht, da eine Auseinandersetzung mit Argumenten der Wahrscheinlichkeit insofern sinnlos sei, weil die Geheimnisse der Religion ohnehin den Schein der Wahrheit gegen sich haben, also ihrerseits nicht wahrscheinlich gemacht oder gegen Wahrscheinlichkeit in Schutz genommen werden können: quand il s'agit d'opposer la raison à un article de nostre foy, on ne se met point en peine des objections qui n'aboutissent qu'à la vraisemblance: puisque tout le monde convient que les mysteres sont contre les apparences, et n'ont rien de vraisemblable, quand on ne les regarde que du côté de la raison (§ 28). Die Wahrheit kann den Schein der Wahrheit gegen sich haben, und sie kann selbst des Scheins entraten" –
...weil ja oft genug vergessen wird dass das "was wir sehen und hören, nie die untersuchten Phänomene selbst sind, sondern nur ihre Auswirkungen" (Fritjof Capra, Das Tao der Physik , Knaur 77324, München 1997, S. 49). Und Blumenberg, in Höhlenausgänge, a.a.O., S. 158/-9: "Zwar gibt es inzwischen eine Astronomie, die nicht mehr auf die phoronomische Berechnung langfristiger Gesetzmäβigkeit eingeschränkt ist. Als Himmelsmechanik und erst recht als Astrophysik vermag sie die Erscheinungen weitgehend zu erklären, sofern man in den Ausdruck 'Erklärung' Voraussetzungen eingehen lässt, die ihrerseits dem strikten Anspruch auf Erklärung entzogen sind", denn "das Unerklärte umschlieβt das Erklärte in unvorstellbarem Ausmaβ " (Sigmund Ginsberg). Auch eine "distinction du genre de celle que la découverte de Gödel nous oblige à faire entre la vérité et la démontrabilité formelle / Unterscheidung jener Art wie sie die Entdeckung Gödels uns zu machen zwingt zwischen Wahrheit und formaler Beweisbarkeit" (Jacques Bouveresse, Conférence du 17 juin 1998 à l'Université de Genève, in: Athena //un2sg4.unige.ch/athena/ bouveresse/bou_pens.html#Note5) ist hier zu berücksichtigen. [Nicht fehl am Platz ist wohl auch ein bekannter Ausspruch Einsteins: "Soweit die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie nicht gesichert; und soweit sie gesichert sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität."]
Читать дальше