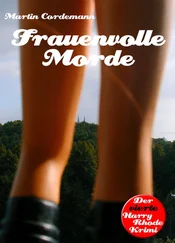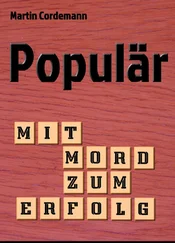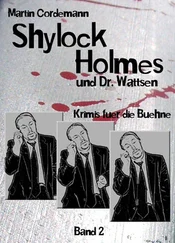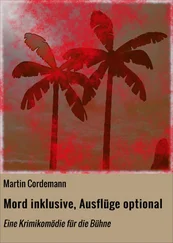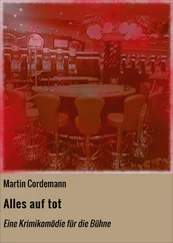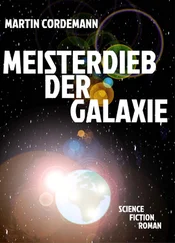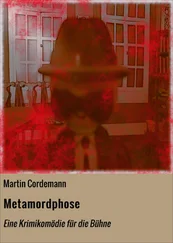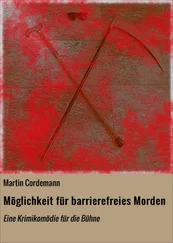Intensive Durchsicht alter Fotos gehörte genauso dazu, wie kapitellange Beschreibungen eines einzigen Dachgiebels, der zwar in der Handlung keinerlei Bedeutung hatte, aber dessen Beschreibung einfach irgendwie in die Zeit gehörte. Damals hatte man noch so gebaut. Damals sahen die Häuser noch so aus. Damals nahm man sich noch die Zeit, wenn man von der Schicht in der Zeche zurückging in die Arbeitersiedlung, innezuhalten und einen Giebel zu betrachten. Es gab ja auch kein Fernsehen, also was hätten die Kumpel sonst tun sollen? An der Trinkhalle stehen und sich gegenseitig was husten?
Allein 370 der insgesamt 850 Seiten würden die Orte beschreiben. Nicht nur die malerischen Giebel, auch die rauen Schornsteine der grauen Fabrik, die Fördertürme der Bergwerke, die schwarzen Gesichter der Kumpel, in denen sich die Kohle (doppeldeutig, aber bitte herausarbeiten welche gemeint ist, um den Scherz herauszunehmen) als Triebfeder dieser Menschen widerspiegelte, eine Art Metapher für die Menschheit selbst, denn dort wo diese Menschen arbeiteten, würden sie auch nach einem langen, harten, arbeitsamen Leben wieder enden: unter der Erde.
Hier haben wir ein wenig vorweg gegriffen und schon auf die Aussage des Buches hingewiesen, ohne die ein solches natürlich schon überhaupt gar nicht in Angriff genommen werden kann. Eine Aussage muss einfach sein, denn sonst ist es keine wirkliche Literatur. Sonst ist es nicht bedeutend. Nicht wichtig. Nicht lesenswert. Unterhaltung war etwas für die Massen. Die kleinen Schreiberlinge. Nichtssagende Nullen, die ihre Zeit mit Populärtexten wie Krimis verbrachten. Solche Leute hatten keine Klasse. Und keine Aussage. Hier dagegen stand die Aussage im Vordergrund. Und wenn man 768 Seiten benötigte, um zu sagen: „Krieg ist schlecht“, dann war es das wert. Denn die Aussage stand im Vordergrund. War das Wichtigste. War das Buch!
Aber das waren nur kleine Teile eines viel größeren Puzzles. Blieb immer noch ein anderer Punkt. Die Handlung. Ohne die konnte der Konstruktionist weder mit der Beschreibung der kohleschwarzen Gesichter oder der großen Augen der Kinder beginnen, die sahen, wie ihre Väter nach getaner Arbeit und mit dunkler Arbeitskleidung aus dem großen Tor der Zeche herauskamen, noch mit der des Giebels. Denn all das musste sich der Handlung unterordnen. Musste seinen Platz im Gesamtwerk finden. Die Stelle im Leben, an die es gehörte. So wie im richtigen Leben. Also wurde getüftelt. Nein, Verzeihung. Es wurde konzipiert. Haarfein. Die Hauptfigur mit Lebenslauf. Was würde ihr wann geschehen? All dies wurde fein säuberlich zu Papier gebracht. Der gesamte Faden, von A nach B nach C nach D. Keine Abkürzungen, keine Umleitungen. Eine ganz klare Linie. Und alle Personen, die ihr begegneten. Die Kinder, die Arbeiter, der Postbote... der Giebel! Auch er war eine Person, denn er stand für etwas. Er wurde personalisiert. Es gab ein komplettes Dossier über ihn, wann er gebaut worden war und von wem, wer unter ihm gewohnt hatte, wer sich unter ihm geliebt hatte, wer unter ihm gespielt hatte, wer seine starken Balken genutzt hatte, um sich daran zu erhängen. All diese Ereignisse hatten den Giebel geformt, ihn zu einer Persönlichkeit werden lassen. Zu dem, was er jetzt ausstrahlte. Und dann die Bombardements im Krieg. Die Bomben, die um ihn herum niedergingen und die Nachbargiebel zerstörten. Der Blindgänger, der durch seinen Dachfirst schlug, aber nicht explodierte. Die Bergungsarbeiten, die den Blindgänger aus den Tiefen seiner Eingeweide entfernten. Der Versuch, die Bombe zu entschärfen... und der Tod des Entschärfers bei diesem Versuch, weit weg, in einer Deponie am Rande der Stadt. Oder... war der Krieg erst viel später gewesen? Lange nach der Zeit, in der das Buch spielt? Recherchieren!!!
So wurde in langer und intensiver Arbeit (ca. 3 Jahre, vielleicht auch 5) die Handlung Stück für Stück zusammengesetzt. Jedes kleine Teilchen wurde notiert und an ein anderes kleines Teilchen gesetzt, die Personen wurden eingefügt, die Orte, die Geschehnisse. Bis alles passte. Bis das Gesamtbild ein ganzes war. Und man beginnen konnte. Mit etwas schwierigem. Heiklem. Bedeutsamen. Wichtigen. Unerlässlichen. Dem ersten Satz!
Genau genommen dem ersten Wort! Denn bereits hier setzten die Probleme ein. Was sollte das erste Wort sein? Ein Artikel? Auf keinen Fall ein Artikel! Niemand, der etwas auf sich hielt begann ein Werk der Weltliteratur mit einem Artikel. Ein Artikel am Anfang war vulgär. Primitiv. Schlampig. Eines Schriftstellers nicht würdig. Man konnte nicht einfach schreiben „Die Sonne schien.“ Das war unmöglich. Auch wenn es zutreffend war. Natürlich schien die Sonne! Es war ein herrlicher Tag. Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Kein Lüftchen regte sich und die Leute saßen auf den Bänken im Stadtpark und ließen sich die Sonne aufs Gesicht scheinen. So war es. Aber das konnte man doch nicht so schreiben! Und auf keinen Fall konnte man das Buch so anfangen. „Die Sonne schien“ war banal, flach und belanglos. Es brachte den Leser in die völlig falsche Stimmung, gab ihm eine völlig falsche Einstellung zu dem, was in ca. 400 Seiten passieren würde. Da konnte man ihn nicht mit so einer Profanität behelligen. Außerdem durfte man den Leser nicht unterschätzen. Man musste ihm nicht sagen, dass die Sonne schien. Das würde er auch so merken. Aus dem Zusammenhang. Aus der Beschreibung der Menschen, der Umgebung. Dafür brauchte man ihm nicht mit dem Holzhammer klarzumachen, dass „die Sonne schien“. Jeder, der einen solchen Tag schon einmal erlebt hatte, konnte das ohne viele Worte nachvollziehen. Und, das war das Schöne daran, auch wenn das Buch in einer anderen Zeit spielte. Der Leser würde sich trotzdem so vorkommen, als wäre er dabei gewesen. Auch wenn er damals noch nicht mal geboren war. Nur, weil er sich in das Gefühl hineinversetzen musste. Selbst wenn auf den ersten 90 Seiten noch nicht viel mit Gefühl oder Menschen passieren würde, immerhin ging es erstmal darum, dem Leser die Umgebung zu beschreiben, den Ort des Geschehens.
„Grelles Sonnenlicht durchflutete die Vorhänge.“ Nein, das war völliger Blödsinn. Es gab ja gar keine Vorhänge. Nirgendwo hatte er etwas von Vorhängen stehen. Gardinen bestenfalls, aber die waren total verblichen. Wie das damals eben so war. Aber würde das Sonnenlicht durch verblichene Gardinen fluten? Wohl eher nicht. Und schon gar kein „grelles“ Sonnenlicht. Grell war ein so vulgäres Wort. Grell waren die Lippen der Hure auf Seite 623, aber doch nicht das Sonnenlicht. War „durchflutete die Vorhänge“ überhaupt richtiges Deutsch? Müsste es nicht eher heißen „flutete durch die Vorhänge“? Aber das klang ja überhaupt nicht gut. Und es waren ja auch Gardinen.
Eine Woche hin und her feilen und der erste Satz stand noch immer nicht. Verschiedene Ansätze kamen auf:
„Es war hell.“ – Unverständlich, flach, platt.
„Sonnenschein erfüllte das Zimmer.“ – Die Gardinen waren zugezogen, das war wichtig für das Zusammentreffen auf Seite 243, und überhaupt welches Zimmer?
„Der kleine Junge mit der Eistüte lief die Straße hinunter.“ – Das würde viel Arbeit bedeuten, denn bislang gab es keinen kleinen Jungen, hier wäre eine komplette neue Biographie notwendig... und außerdem stand ein Artikel am Anfang!
„Eistüte lief die Straße hinunter.“ – Was war eine Eistüte? Gab es die zu der Zeit, in der das Werk spielte überhaupt noch? Oder schon? War hier nicht eher ein Eis am Stiel angemessen? Und führte das Auslassen des Artikels wirklich zum Erfolg?
„Eis lief die Straße hinunter.“ – Besser, aber missverständlich. Eis könnte eine der Personen des Buches sein und der Leser würde sich fragen, warum er ganz am Anfang die Straße herunter lief und wieso er danach nie wieder auftauchte. Vielleicht doch eher irgendwas mit der Sonne?
„Sonne schien.“ – Zu ungenau. Welche Sonne, und wohin?
Читать дальше