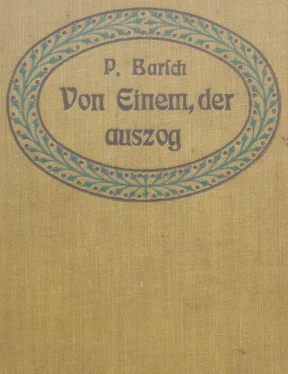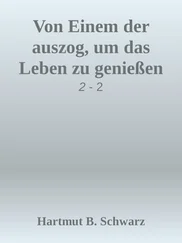Ein Vorgang kam mir in den Sinn, der sich vor vielen Jahren ereignet hatte. Ich sollte einst beim Fleischer einen Auftrag meines Vaters bestellen und sah bei dieser Gelegenheit, dass der Bleischergesell eine Kuh in den Schlachtraum zog. Er schlug die Kuh mit einem Stecken und rief dabei lachend einer Magd zu, die am Hoftore stand: „Komm, Therese, den Schwanz halten, damit sie stille hält, wenn ich sie ermurkse!“ Mich ergriff damals ein grauenhaftes Entsetzen vor dem Fleischergesellen; in meinen Augen war er ein Unmensch, weil er kein Erbarmen mit der Kuh empfand und noch lachen und scherzen konnte, bevor er sie ermordete. Für mein Fühlen war das etwas unerhört Widernatürliches, und schnell suchte ich fort zukommen aus dem Bereich der Blutstätte. Laut weinte ich vor mich hin und wusste nicht, ob aus Mitleid für unglückliche Kuh, oder aus Empörung darüber, dass solche Dinge in der Welt möglich waren. Ähnlich erging es mir jetzt, da Franz unter rohem Spottgelächter hinausgeführt wurde. Ich wusste, dass meine Entrüstung und Weichherzigkeit lächerlich war, dass es der Beruf eines Fleischergesellen sei, Tiere zu schlachten, und dass ein Zahn, der herausgezogen worden, keinen Schmerz mehr verursachen könne; doch das Gefühl des Abscheus verließ mich nicht.
Was war ich doch für ein schwächlicher, weichlicher, dummer Mensch! Währen ich in Ängsten und Grauen zitterte und die Hände verstohlen an die Ohren presste, kehrte Franz, von vielen Kunden begleitet, wohlbehalten in den Saal zurück. Eilig kam er auf seinen Platz; aus den wenigen Worten, die ich ihm herauspresste, und aus der lebhaften und listigen Unterhaltung der Kunden erfuhr ich, dass er mit dem Stuhle zusammengebrochen und der Zahn im Munde geblieben sei. Aber der Schmerz hatte nachgelassen. Der Rüsselschaber kam an unseren Tisch, redete grobe, beleidigende Worte und tat so, als wollten wir ihn um seinen Lohn prellen. Ich gab ihm die vereinbarten zehn Pfennige, und befriedigt ging er davon. Wir kauften uns später ein Abendbrot. Als wir noch aßen, erschien ein Mann, den wir bis dahin noch nicht gesehen hatten, stellte sich mitten ins Zimmer, faltete die Hände und begann zu beten. Die Gäste hörten stehen zu. Nach dem Gebet stimmte der Mann ein Lied an. Uns wurde ein Buch auf den Tisch gelegt, in dem das Lied gedruckt stand; ich sang nicht mit, da mir solches Beten und Singen in einer Gaststube zu neu und zu wunderlich vorkam. Alle die Gäste, die jetzt so fromm taten, hatten kurz vorher kein Mitgefühl für Franz empfunden; hatten sich sogar an seiner Qual ergötzt und ihn verspottet. Das machte mich nachdenklich.
Zeitig gingen wir zur Ruhe. Vorher hatten wir uns nach dem Preise des Nachtlagers erkundigt. Unser Geld reichte hin; doch nur noch eine Kleinigkeit blieb uns übrig. Vor dem Schlafzimmer angelangt, mussten wir Halt machen und Rock und Weste ausziehen, worauf zwei Angestellte der Herberge die Kragen unsere Hemden und die Nähte an unseren Unterkleidern einen peinlichen Besichtigung unterzogen. Ich erfuhr, dass jene Gäste, bei denen man verdächtige Zeichen entdeckte, auf einer Strohstreu schlafen mussten. Wir drei wurden als rein befunden und durften in Betten schlafen. Ich teilte mein Bett mit Franz; dadurch ersparten wir dreißig Pfennige.
Der Saal, in dem wir lagen war groß und umfasste viele betten. Alle unsere zahlreichen Schlafgefährten plauderten; doch hörte ich nicht zu, und ich war auch unfähig, selber ein Wort zu sagen. Starr war ich geworden vor Müdigkeit und besaß nicht mehr die Kraft und den Willen, meine Glieder zu rühren…
Wo befand ich mich?… Zunächst wurde mir klar, dass ich in einem weichen, warmen Bette lag, und nachdem sich meine erwachenden Lebensgeister alle versammelt hatten, wurde mir kund, dass ich in der Herberge zur christlichen Heimat in Breslau weilte.
Breslau!… Ein Hochgefühl beseelte mich bei dem Gedanken, dass ich in der großen Stadt geschlafen hatte.
Der junge Tag lugte durch die Fenster, und sein Schimmer war kräftig genug, den weiten Schlafsaal zu erhellen. In drei langen Reihen stand Bett an Bett; in vielen Betten lagen zwei Personen, in einem sogar drei. Bei der spärlichen Beleuchtung am Abend hatte ich den Saal nicht übersehen können; auch waren meine Sinne von der übergroßen Müdigkeit gelähmt gewesen. Alle die vielen Schlafgenossen schliefen noch; ich allein war munter. Behutsam, weil ich Franz nicht wecken wollte, hüllte ich mich fest in die warme Decke, dehnte und streckte den Körper und gab mich ganz dem kostbaren Genuss der Ruhe und der bunten Träumerei hin.
Der Vormittag mochte schon weit vorgeschritten sein, als vom Flur her eine derbe Mannesstimmer erscholl. „Jetzt ist’s aber die höchste Zeit! Die Schlafzimmer werden ausgeräumt! Rrraus!“
Ich weckte Franz und sprang sogleich aus dem Bett. Auch einige andere erhoben sich, darunter Johann. Die meisten blieben liegen. Wir zwei waren die ersten, die den Schlafsaal verließen. Nachdem wir unsere Papiere, die uns abends abgefordert worden waren, geholt hatten, schieden wir aus der Herberge.
Das Wetter war trüb und der Wind fegte kalt durch die Straßen. Gedankenlos, ohne Plan, und müde, trotz der langen Ruhe, gingen wir an den Häusern entlang. Die Menschen hasteten an uns vorüber, als hätten sie alle die größte eile. Ich ließ die Blicke umherschweifen, ohne den Wunsch zu empfinden, merkwürdige Dinge zu sehen. Erst als wir eine Gegend erreichten, in der nur noch vereinzelte Häuser standen und bereits Wiesen und Äcker sichtbar waren, fiel mir ein, dass wir die viel gerühmte Gebäude, den Dom, die Liebichshöhe, das Rathaus, den Bischofspalast und auch die Denkmäler nicht gesehen hatten. Jetzt erinnerte ich mich, dass ich gern auch den Schweidnitzer Keller gesehen hätte, wie auch das Haus, in dem General Tümpling wohnte, der alle Jahre zweimal in unsere kleine Stadt zu kommen pflegte und dem zu Ehren es dann jedes Mal Parade, Zapfenstreich und Fackelbeleuchtung gab. Nur eine einzige Merkwürdigkeit war mir zu Gesicht gekommen: ein Schild mit der Aufschrift „Gasthaus zum Turnvater Jahn“. Ich kannte den Turnvater Jahn aus Büchern, und da ich der Meinung war, dass er in jenem Hause gewohnt habe, freute ich mich, es gesehen zu haben.
Keiner von uns hatte daran gedacht, in Breslau nach Arbeit zu fragen, und auch jetzt fragte keiner, wann unsere Wanderschaft enden und was aus uns werden solle. Wir konnten nicht fechten, und unser Geld war zu Ende gegangen. Nur noch wenige Pfennige besaßen wir. Meine Hoffnung ruhte auf Johann. Ich wusste zwar nicht wie er es anfangen werde, uns aus der Not zu retten; doch rechnete ich auf seinen Mut und seine Klugheit. Ein Wagen kam gefahren.
„Dürfen wir mit?“ schrie Johann.
Der Kutscher lud uns durch eine Handbewegung zum Aufsteigen ein, fuhr jedoch im Trabe weiter. Wir rannten dem Wagen nach; doch nur Johann erreichte ihn und klomm hingen empor. Ich wäre wohl auch hinauf gekommen; doch zögerte ich, da Franz zurückgeblieben war, und der Kutscher wartete nicht auf uns. Johann winkte vom Wagen mit der Mütze; ich winkte gleichfalls und schrie ihm zu er solle, wenn er abgestiegen, auf uns warten. Franz und ich sahen ihm neidisch nach. Wir hofften, ihn im nächsten Dorfe zu finden, und schritten tüchtig aus. Aber wir fanden ihn nicht, obgleich wir uns genau umsahen und eine Weile auf der Dorfstraße warteten.
„Vielleicht in dem Dorfe, das jetzt kommt!“
„Weiter also! Immer antreten, so gut es geht, damit er nicht zu lange warten muss!“
Nach langem Marsche erreichten wir ein Städtchen, das Lissa hieß. Auch dort war Johann nicht zu erblicken. Wir waren jetzt todmüde, ach! und hungrig, doch mussten wir weiter. Denn was sollten wir ohne Johann anfangen! Weiter – weiter!… Franz weinte schon wieder. Er beteuerte, nicht mehr laufen zu können. Ich beschwor ihn, alle Kraft aufzubieten, und erklärte ihm, dass wir ohne Johann verhungern müssten.
Читать дальше