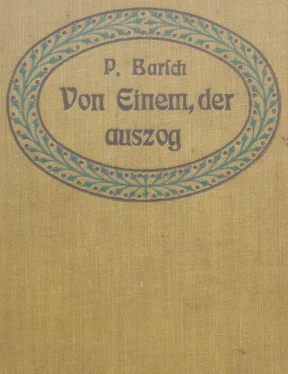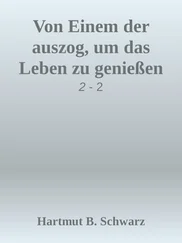Doch – ich brach mein Versprechen. Vor dem nächsten Bauerhause entdeckte ich nämlich, dass der Düngerhafen im Hofe recht klein war. „Die haben zu wenig Vieh, - die geben nichts!“
Johann entgegnete schroff, der Düngerhaufen wäre nicht maßgebend; doch er gestattet schweigend, dass ich ein anderes Gehöft wählte. Ohne ein passendes Gehöft für mich gefunden zu haben, erreichten wir das Ende des Dorfes. Um Johanns Zorn zu beschwichtigen, leistete ich den Schwur, in dem jetzt folgenden Dorfe ganz bestimmt zu fechten, gleichviel, ob dort die Düngerhaufen groß oder klein seien. Eine halbe Stunde später war der Zeitpunkt gekommen; mein Gelöbnis musste ich nun einlösen.
„Wenn Du jetzt wieder nicht magst, so kannst Du heimgehen zu Mutter!“ spottete und drohte Johann.
„Lasst mich zufrieden! Ich werde schon mögen!“
Herzhaft schritt ich voraus, fest entschlossen, mein Wort zu halten. Dem großmäuligen Freunde wollt ich zeigen, was ich leisten konnte. Ich gelangte aber tief in das Dorf, ohne ein Haus zu finden, das mir für meinen Zweck geeignet erschienen wäre. An jedem Gehöft schreckte mich irgendetwas ab. Hier war es ein Hund, dort eine Person, die im Hofe weilt und wenig freundlich aussah; dann wieder erinnerte mich ein Haus durch seine Bauart an einen geizigen Bauer in meiner Heimat, und beim Betrachten anderer Häuser und Höfe gewann ich den Eindruck, dass die Bewohner arm seien. An einem großen Bauerngute ging ich vorbei, weil es Ähnlichkeit mit dem Gute meines Vormunds hatte… Der künstlich entfachte Mut war verlodert; aber da ich unmöglich wortbrüchig werden konnte, blieb ich schließlich vor einem Hoftore stehen, in der ernstlichen Absicht, einzudringen. Nachdem ich einige Male leise den Spruch hergesagt hatte „Ein armer reisender Handwerksbursche bittet um eine Unterstützung!“ biss ich die Zähne zusammen, klinkte das Tor auf und drang forsch hinein in den Hof.
Im Hausflur stand eine Frau am Butterfass. Ich war so verwirrt und aufgeregt, dass mir der Fechtspruch nicht einfiel. Doch sie erriet, was ich wollte, deutete nach einer Tür und sagte, ich solle hineingehen. Die Tür stand halb offen, und ich trat der Weisung gehorchend, in die Stube. Am Bettrand saß, nur spärlich bekleidet, eine andere Frau und tränkte ein Kind an der Brust. Sie sah so blass und so gütig aus, dass ich plötzlich ein inniges Bertrauen zu ihr empfand. Meine Scheu wich, und ich trat auf sie zu und wollte sie anreden; doch sie stieß einen gellen Hilfeschrei aus. Die Frau vom Butterfass und andere weibliche Personen kamen herbeigestürzt; heftig erschrocken wich ich zurück und wollte davonlaufen; im Hausflur aber zupfte mich die Frau vom Butterfass am Ärmel und hieß mich warten. Wenige Augenblicke später drückte sie mir ein Hühnerei in die Hand. Aus der Stube erscholl die klagende Stimme der Bäuerin: „Das Bettelpack wird alle Tage frecher!… Eim Bette werd ma überfalln. Der Schandarm kümmert sich gar nimme nich drum! Au heute ab gibs nischte nimme bei uns!“ - - Und sie hatte so mild und so schön wie die Himmeslmutter ausgesehen mit ihrem Kinde am weißen Busen!… Schnell rannte ich zum Hofe hinaus.
Das Ei tröstete mich. Triumphierend hielt ich es den Freunden entgegen. Sie freuten sich mit mir, und Johann sagte belobigend: „Na siehste!“
Franz meinte sinnend, wenn wir alle Tage Eier kriegten, würden wir ganz gut leben können in der Fremde. Ich ermahnte jetzt die Freunde, ihre Pflicht zu tun, da ich die meinige getan habe. Ermuntert durch meinen Erfolg, begingen auch sie ihre erste Fechtertat. Jeder begab sich in ein Gehöft. Aber beide kehrten mit leerer Hand zurück, Johann schimpfend, Franz traurig. „Es kommen zu viele!“ hatte Johann zur Antwort erhalten, und Franz war abgewiesen worden, weil es Frühjahr sei, wo es doch überall Arbeit gäbe.
„In der Gegend fecht’ ich nich wieder!“ sagte Johann zornig. „Das sein ja elende, krüppelige Hungerleider!“
Ich verteidigte die Bewohner der Gegend und wies auf mein Hühnerei hin. Meines Erfolges durfte ich mich leider nicht allzu sehr rühmen, weil Johann, der ohnehin seine gute Laune verloren hatte, gar leicht hätte ungemütlich werden können. Hinter der Ortschaft erwogen wir die Frage, was mit dem Ei geschehen solle. Johann war geneigt, es auszutrinken; er meinte, dass er zufällig Appetit auf ein rohes Ei habe. Ich lehnte seinen Wunsch empört ab und schlug vor, das Ei hart zu kochen und in drei gleiche Teile zu zerlegen. Fein gehaktes Ei, auf Brot gestreut, schmeckte vorzüglich, und wir könnten uns auf solche Weise das feinste Mittagessen herrichten. Der gute Wert dieses Ratschlages fand Anerkennung, und so kamen wir überein, trockenes Gras, Papier, Stroh und Reisig zu sammeln, Feuer anzuzünden und unseren kostbaren Schatz in einem Scherben zu kochen. Ein Feuer brachten wir mit einiger Mühe zustande; an Wasser war auch kein Mangel, doch ein Topfscherben nicht zu finden. Ich hielt das Ei mit der Hand über das Feuer, in der Meinung, das Dotter müsse durch die Einwirkung der Hitze hart werden. Johann brachte und dabei durch allerlei spöttische Bemerkungen und Späße zum Lachen; besonders dadurch, dass er Franzens Mütze mit Schneewasser füllte und sie als Kochgeschirr empfahl. Seinen Wunsch, das Ei selbst über Feuer zu halten, damit ich mir nicht zu dem verbrannten Munde noch die Finger verbrenne, lehnte ich ab, da er es sonst wahrscheinlich ausgetrunken hätte. Da knackte plötzlich die Schale, und das flüssige Gelb rann in die Asche… Ein dreifacher Wehruf…
Johann fand zuerst die Fassung wieder. Er drückt das Feuer aus und suchte zu retten, was zu retten ging, in dem er die Asche wegblies und das Dotter so gut als möglich aufleckte.
„Hätt’ ich’s nur bald genommen und ausgesoffen!“ rief er ärgerlich.
Franz und ich grämten uns den ganzen Tag über den schweren Verlust.
Das Dörfchen, dessen Gasthaus uns am zweiten Abend unserer Wanderung Quartier gab, hieß Schweinebraten. Der Name kam uns sonderbar und komisch vor, und wir fragten die Magd, die uns in der Kammer ein Strohlager bereitete, ob sie täglich Schweinebraten zu essen bekomme.
„Alle Tage is nich Kermes“, erwiderte sie und lachte.
Auf eine Frage, die ich stellte, gab sie den Bescheid, das Dörfchen führe ihres Wissens diesen Namen, weil einst der Alte Fritz darin eine Portion Schweinebraten gegessen habe. Sie selber müsse mit Kartoffeln und Buttermilch zufrieden sein; den Schweinebraten könne sie sich, wenn sie wolle, dazu denken. Einen Scherz derber Art, den sich Johann mit ihr erlaubte, erwiderte sie durch Grobheiten. Sie nannte Johann einen Rotzlöffel und sagte, er sei ihr noch zu grün „für fitte Faxen“. Da Johann fortfuhr, sie auf hässliche Art zu necken, ließ sie von der halbfertigen Arbeit ab. „Macht Euch Euer Lausepocht alleene zurechte!“ schrie sie wütend und ging fort.
Ich war betroffen von der Dreistigkeit Johanns. Und ich erstaunte noch mehr über eine Unterhaltung, die sich zwischen ihm und Franz entspann und nach meinem Empfinden maßlos gemein war. Solche Reden hatten sie noch nie geführt, und sie kamen mir nun plötzlich vor wie Menschen, mit denen man zum ersten Male beisammen ist. Johann war ja in Liebesdingen schon gut erfahren; dass aber Franz – der dumme Franz! - Jetzt das Hauptwort führte und den älteren Gefährten in garstigen Ausdrücken und Erzählungen übertrumpfte, kam mir fast unbegreiflich vor. Ihre Unterhaltung war mir widerwärtig und anziehen zugleich. Das Weib galt mir als das sonderbarste aller dunklen Geheimnisse. Wenn meine Seele sich mit diesem Geheimnis beschäftigen wollte, erschauerte sie in Andacht, Verehrung und inniger Sehnsucht; zuweilen aber drang in diese heilige Feier der Misston eines schmutzigen Empfindens. Alsdann erschien mir das Weib als etwas Unreines, Schandhaftes, und ich freute mich, dass ich ein Junge geworden war. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätt’ ich mich ja schämen und vor den Menschen verbergen müssen. Ganz unerklärlich war es mir, dass eine Frau ein Land regieren konnte. Bei diesem seltsam verwirrten Gemütsverhältnis war es natürlich, dass ich den Mann als ein Wesen betrachten musste, das hoch über dem Weibe stand; doch hinderte mich dieser Glaube nicht, schönen Frauen und Mädchen in Gedanken untertan zu sein und mein ganzes Leben heimlich ihrem Dienste zu weihen. Schon als kleiner Knabe trug ich ein sehnsüchtiges Begehren nach milder Frauenliebe und Frauengüte im Herzen. In der Zeit vom elften bis zum dreizehnten Jahre lebte ich nämlich neben dem wirklichen Leben, das hart und trostlos war, ein herrliches, märchenbuntes Traumleben. Wenn ich unter der Zucht meines gestrengen Vaters unablässig schwer arbeiten musste, nie über Müdigkeit klagen durfte und schon bei geringen Vergehen oder Versehen harte Schläge zu befürchten hatte, dachte ich gern an unser schönes Schlossfräulein, das oft an unserem Hause vorbei ritt. Ich ersann die allerprächtigste Geschichte, in der ich durch kühne Taten zu Ruhm und Reichtum gelangte und einen Schimmel zum Reiten besaß. Das Schlossfräulein war meine Herzliebste; wir ritten miteinander über die Felder, in den Wald und durch das Dorf. Vor dem Wirtshause stiegen wir ab und ließen uns solches Bier bringen, wie es die Offiziere zu trinken pflegten, wenn Soldaten bei uns im Quartier lagen. Den Leuten, die uns bewundernd zusahen, geben wir Geld, damit auch sie das gute Bier zu kosten bekämen. Bei jenen Kapiteln meiner Geschichte, in denen mich die Menschen bewunderten und rühmend von mir redeten, verweilte ich am liebsten und am längsten. Jeden Tag spann ich den Roman weiter; jeden Tag befand ich mich an der Seite der vornehmen Liebsten, zu der ich in Wirklichkeit kaum aufzublicken wagte, und jeder Tag brachte neue Freunden, neue Abenteuer und neue Küsse. Doch so innig ich mit ihr vertraut war, und so willig und freudig sie alle meine Wünsche erfüllte – wir blieben die keuschesten Kinder. Eine Grenze bestand, über die sich meine sonst unerschrockene Phantasie nicht hinauswagte, obzwar von drüben her im leisen Dämmerlichte der Ahnung ein paradiesischer Garten winkte.
Читать дальше