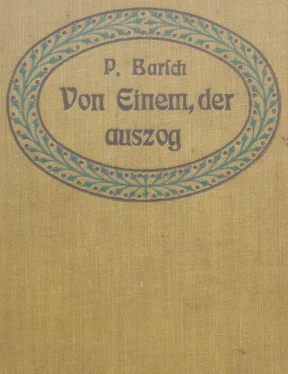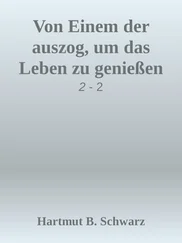Johann beteuerte wieder, dass Breslau ein elendes Nest sei im Vergleich zu Berlin; doch bürstete und putzte er so fleißig, wie Franz und ich. - - Beim schwachen Reste des Tageslichtes zogen wir dann in die Stadt ein. Soviel ich auch den Blick umherschweifen ließ, vermochte ich doch nichts von den erwarteten Herrlichkeiten zu sehen. Die Straße, die wir durchschritten, war lang und breit; aber die Häuser und Schaufenster waren nicht größer und schöner als in der kleinen Stadt, aus der wir kamen. Nur die Pferdebahn fand meine Bewunderung. Ich erstaunte über das Pferd, das mit Leichtigkeit einen Wagen ziehen konnte, der fast so groß war, wie ein Eisenbahnwagen, und ich glaubte, es müsse dressiert sein wie ein Zirkuspferd, wie es immer schnurgerade zwischen den Schienen lief. Voll Spannung verfolgte ich seinen Lauf, beständig in der Erwartung, es werde einen Fehlsprung nach rechts oder nach links machen und den Wagen zum Entgleisen bringen; doch es entgleiste kein Wagen.
Manchmal sah ich Männer auf der Straße stehen, die dunkelblaue soldatische Uniformen und Helme trugen. Der Säbel befand sich unterhalb des Rockes; nur der Griff und unten das Ende der Scheide waren zu sehen. Das hielt ich für etwas Sonderbares. Allmählich kam ich auf die Vermutung, dass diese Männer Polizisten seien. Vielleicht keine richtigen Polizisten, da sie doch sonst wohl rote Kragen gehabt hätten und nicht so gleichgültig gewesen wären gegen uns Handwerksburschen. Sie sahen friedlich und freundlich aus, ganz anders als daheim die Polizeimänner, und achteten gar nicht auf uns, obgleich wir an einigen ganz nahe vorüber strichen. Ich gewann ein solches Vertrauen zu ihnen, dass ich kühn an einen herantrat und fragte, wo die Herberge sei.
„In welche Herberge wollen Sie?“
„Wenn’s eine Tischlerherberge gäbe…“
„Geh’n Sie doch lieber in die christliche Heimat!“ riet er mir. „Dort sind Sie am besten aufgehoben. Die christliche Heimat ist in der Holteistraße.“ Er beschrieb uns die Wege und ging einige Schritte neben uns her. Ich war entzückt von seiner Freundlichkeit und hielt es für unmöglich, dass ein solcher Mensch einen anderen Menschen einsperren könne; insbesondere hielt ich ihn für einen Freund der Handwerksburschen.
Fortan gefiel mir Breslau, obgleich ich noch kein prächtiges Gebäude, kein Denkmal und keinen hohen Turm gesehen hatte. In den Gesichtern der Menschen fand ich den gleichen Ausdruck der Güte, den ich im Antlitz des Polizisten gefunden hatte. Ich nahm mir vor, der Mutter eine Schilderung von Breslau zu schreiben und darin hervorzuheben, dass in meinem Heimatdorfe kein einziger Mensch so gut von Herzen sei, wie hier die Polizisten. Aus der Freundlichkeit der Polizei könne sie auf die Freundlichkeit der gewöhnlichen Menschen schließen.
An einige große Schulkinder, die auf der Straße plauderten, richtete ich die Frage, wo der Bischof wohne. Sie wussten es nicht; ein Mädchen aber sagte, ich solle in das Adressbuch sehn. Auch die Kinder gefielen mir. Sie hatten artig geantwortet und höhnten nicht hinter mir her, wie es bei mir zu Hause die Kinder in einem solchen Falle getan hätten. Aber verwunderlich war es mir, dass sie nicht einmal zu sagen wussten, wo der Bischof wohne. Ich dachte so bei mir: wenn ich ein Breslauer Kind wäre, würde ich alle Tage das Haus des Bischofs betrachten und nicht eher ruhen, bis ich ihn einmal selbst und ganz nahe gesehen hätte. Überhaupt war es sonderbar, dass die Breslauer alle so gleichgültig des Weges gingen – ganz so, wie die Menschen in der kleinen Stadt. Kein Gesicht verriet mir den Ausdruck des stolzen Bewusstseins, in einer berühmten Stadt leben zu dürfen. Ich sah sogar Menschen, die noch schlechter gekleidet waren als wir.
Franz weinte wieder. Er sagte nicht, weshalb. Wenn ich ihn fragte, was ihm fehle, weinte er noch mehr.
Endlich fanden wir die Herberge zur christlichen Heimat. Ohne Zaudern gingen wir hinein. In einem großen Zimmer, das einer Wirtshausstube ähnlich sah, saßen Gäste an den Tischen, junge Leute zumeist. Die Unterhaltung wurde in gedämpftem Tone geführt. Einige der Gäste richteten Fragen an uns; doch ich verstand sie nicht und grüßte nur. An einem frei gebliebenen Tische, ganz im Hintergrunde, ließen wir uns nieder. Franz presste beide Hände an eine Wange und schluchzte und stöhnte weiter. Er litt wieder Zahnschmerzen. Auf unsere Ratschläge hörte er nicht, und selbst Johanns eindringliche Ermahnung, einen Zigarrenstummel zu suchen und den Schmerz durch Zigarrenrauch zu betäuben, fand keine Beachtung. Immerzu lispelte er wimmernd, ihm könne kein Mensch helfen; er müsse sterben. Da wurde Johann grob und verbot ihm, uns durch sein Gewinsel zu blamieren. Er erbot sich, mit ihm hinauszugehen und den kranken Zahn mir einem Bindfaden herauszuziehen. Aus den Schnüren seines Bündels löste er einen Faden und bereitete daraus eine Schlinge. Da die Lampe nur wenig Licht nach unserem Tische entsendete und die Gäste sämtlich in ihre Unterhaltung vertieft waren, verstand er sich auf mein Zureden dazu, sein Kunststück im Zimmer zu vollbringen. Franz wurde gezwungen, zwischen Bank und Tisch auf die Diele niederzuknien, so dass die Gäste seinen Kopf nicht sehen konnten,
„Nicht mucken! Sonst . . .“
Johann versuchte, seine Schlinge an den kranken Zahn zu befestigen und sah sich dabei genötigt, gleichfalls unter den Tisch zu schlüpfen. Leider ging die Arbeit nicht so lautlos vor sich, wie wir gehofft hatten. Franz ächzte und stöhnte, und da er den Mund nicht so weit aufriss, wie Johann es wünschte, wurde er von diesem gescholten. Die Gäste sahen zu uns herüber und jemand rief: „Die Kunden dort werden meschugge!“
Johann fuhr empor aus dem Versteck; auch Franz nahm seinen Platz auf der Bank wieder ein. Mehrere Personen traten zu uns heran und besahen uns mit sonderbaren Blicken. Damit sie nicht auf die Vermutung kämen, dass wir am Ende irrsinnig seien, sprach ich rasch: „Der hier hat Zahnschmerzen und weiß sich keinen Rat mehr.“
„Zahnschmerzen? – Rausziehen! Das einfachste!“
„Den Pfropfenzieher nehmen und rausdrehen!“
„A’n Hammer und a Stemmeisen und rausstemmen!“
„’s beste is eene Maulschelle, dass der Zahn vor Angst alleene raus springt.“
„Geh zum Schmied, borg Dir eene Zange und bring se her! Ich zieh ihn raus!“
So machten sich die herzlosen Menschen lustig über den armen Franz, und als sie sahen, dass er weinte, spotteten sie noch heftiger. Einer jedoch, ein junger blasser Mensch, nahm nicht teil an diesem Gespött; er erklärte sich ernsthaft bereit, den Zahn zu ziehen; er habe das Zahnziehen studiert und besitze die nötigen Instrumente.
„Wenn’s nur nicht zu viel kosten möchte!“ entgegnete ich ihm zaghaft.
„Eenen Bleier!“
„Was ist das?“
„Der da frägt, was ‚n Bleier is!“
Als ob ich eine urkomische Frage gestellt hätte, lachte die ganze Gesellschaft und belustigte sich über uns. Nur der junge blasse Mensch blieb ernst. Ein Bleier, sprach er, seien zehn Pfennige. Beim richtigen Zahndoktor koste das Ausreißen drei Flachsen; er reiße den Zahn viel geschickter und verlange nur einen Bleier.
„Ja, der kanns!“ versicherte einer aus der Schar. „Der is Rüsselschaber und Doktor.“
„Wenn der mit seiner Zange einen Meilensteen an der Chaussee anfasst – riß! Is der Steen raus.“
Zehn Pfennige, - das war nicht viel. „Wollen wir?“ wandte ich mich an Johann.
„Los!“ entgegnete er, und dein Gesicht verriet, dass er sich auf das Vergnügen freute.
„Also los!“ rief der Rüsselschaber und Doktor, nahm einen Stuhl und verließ damit das Zimmer. Franz war furchtsam, ließ sich aber von Platze zerren und in den Hof führen. Ich ging nicht mit hinaus. Die erwartungsvolle Freude der andern an dem Schauspiele war mir unfassbar, widernatürlich, empörend. Außerdem litt ich vielleicht mehr Angst, als Franz selber.
Читать дальше