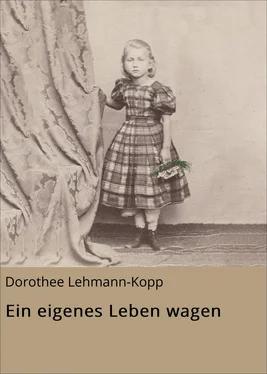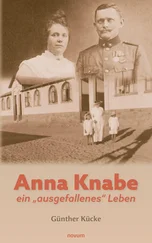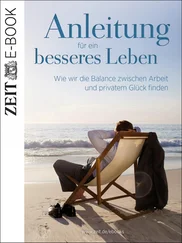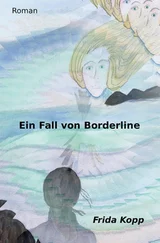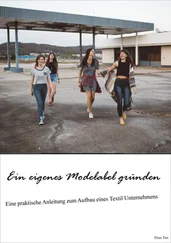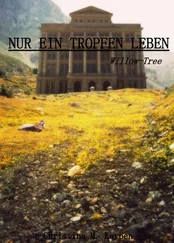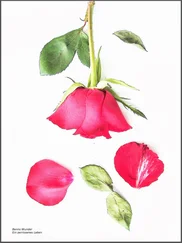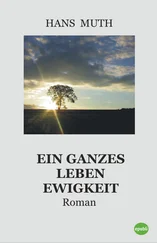Willem fiel in der Aufregung erst später auf, dass es keinerlei Grund gegeben hatte, ein Päckchen an der besagten Haustür vorbei zu bringen. Aber da war die Verabredung schon getroffen, und die Dinge nahmen ihren Lauf. Mit den Brüdern und dem künftigen Schwager der jungen Damen verstand er sich auf Anhieb. Und diese selbst waren so charmant und bezaubernd, dass er noch nicht einmal erwog, sich dem abendlichen Tanz entziehen. Julie war besorgt, aber Caroline schwebte auf Wolken. Elise und Rudolph schienen von dem ostindisch-niederländischen Geschäftsmann überaus angetan, nahmen auch durchaus gewisse schmachtende Blicke Carolines wahr, dachten sich aber nichts dabei und wurden erst argwöhnisch, als Caroline am Folgeabend gegen jedes comme il faut nur je einen Tanz mit ihren Brüdern und Emil absolvierte und ansonsten ihre Tanzkarte für ihren neuen Bekannten reservierte. Sie hätten ohnehin nichts ändern können; Willem und Caroline hatten sich heftig verliebt, und so kam es, wie es kommen musste: Als das Ende des Aufenthalts in Arolsen nahte, sprach Willem bei Rudolph vor und bat, um die Hand seiner jüngsten Tochter anhalten oder zumindest werben zu dürfen. Rudolph war ehrlich betroffen. Schwärmerei hin oder her – dass sich Caroline mit einem Verehrer ins Einvernehmen setzte, der sie ans andere Ende der Welt bringen würde, hätte er in düstersten Visionen nicht erwartet. Noch dazu in so rasantem Tempo, und nachdem Marie schon den vorgezeichneten Weg verlassen hatte, um als Blaustrumpf und Lehrerin in Marburg zu leben. Gleichzeitig liebte er seine Töchter sehr und wollte sich nicht einer Eheschließung aus Neigung entgegenstellen. Und der Kandidat hatte durchaus auch etwas zu bieten: Sein Wohlstand war beträchtlich, und er plante, auf Java eine Zuckerrohrplantage zu erwerben, um sich dort niederzulassen. Überzeugend waren auch die Bürgen, die er nannte, so dass Rudolph die Richtigkeit seiner Angaben prüfen konnte. Der erhebliche Altersunterschied von fast 16 Jahren war zwar hinnehmbar – er und Elise waren elf Jahre auseinander - aber sein Küken! Es war noch jung, noch keine 16 Jahre alt. Er bat um Bedenkzeit und besprach sich mit Elise.
Schweren Herzens vereinbarten sie am nächsten Tag: Vor dem 18. Geburtstag Carolines käme eine Heirat nicht in Frage. Und eine Verlobung nach wenigen festlichen Tagen ebenfalls nicht. Um die Zuverlässigkeit der Gefühle und Wünsche zu prüfen, möge der Kandidat in einem Jahr vorbei kommen; einem Jahr, das Caroline großenteils bei der Schwester in Cassel verbringen werde, wo sie ein reges gesellschaftliches Leben führen und auch andere junge Männer kennen lernen würde. Sollte die Zuneigung dann noch Bestand haben – dann würde man weiter sehen.
Sie hatte Bestand. Nach einem Jahr und nach einem weiteren Jahr der Verlobungszeit. Willem hatte in der Zeit seine Plantage und ein weitläufiges Wohnhaus eingerichtet, und so fand am 27. März 1881, fast genau zwei Jahre nach der Trauung von Julie, die Hochzeit statt. Trauzeugen waren Emil und Carl. Der Abschied war schmerzhaft, war doch klar, dass zumindest die Eltern ihre Tochter nicht mehr wiedersehen würden. Die mehrwöchige Reise wäre für sie nicht zu bewältigen, und es war unklar, wann und ob die Frischvermählten – erst recht, sobald sich der zu erhoffende Nachwuchs ankündigte - je wieder europäisches Festland betreten würden. Julie und Caroline versprachen sich zwar, ihr inniges Verhältnis nie abbrechen zu lassen, ständig zu schreiben und einander zu besuchen, doch einfach würde das nicht werden, das wussten beide.
Kapitel 3 - Marie
Marburg 1882
„Über ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen“, schrieb Caroline Schlegel 1799 an ihre Tochter. „Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau / Und herrschet weise / im häuslichen Kreise / Und regt ohn Ende / die fleißigen Hände etc. etc…“ Was für ein Frauenbild. Ihr Gatte August Wilhelm Schlegel, der Literaturhistoriker und Philologe, amüsierte sich ebenfalls köstlich: „Ehret die Frauen / Sie stricken die Strümpfe / wohlig und warm zu durchwaten die Sümpfe“, dichtete er weiter. Woran die Wohnkommune der Schlegels, die ganz in der Nähe der Familie Schiller in Jena lebte, solchen Spaß hatte, konnte Marie gerade nicht sehr lustig finden.
Sie hatte ihre Entscheidung, den Lehrerinnenberuf zu ergreifen, nie bereut und liebte ihre Arbeit. Ihrem Vater hatte sie „à la main“ versprochen, sich nie durch die Mitwirkung in Frauenvereinen in Konflikt mit dem Gesetz zu bringen. Noch immer galt das Verbot der politischen Versammlung oder Vereinsgründung für Frauen, das 1850 verabschiedet worden war und ihnen letztlich auch jede agitative Äußerung verbot: Louise Otto hatte die Redaktion ihrer Frauenzeitung an Strohmänner abgeben und das Blatt schließlich ganz einstellen müssen. Obwohl die schriftstellerische Betätigung für Damen des Bürgertums der einzige bis dahin unangefochtene Beruf gewesen war. Mit ungeheurer Produktivität verfasste sie weiterhin Romane. Um sich jedoch in breiterer Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und Türen für den Kampf um Emanzipation und Gleichberechtigung zu öffnen, ohne unter das politische Verdikt zu fallen, hatte sie mit zwei Mitstreiterinnen eine Hintertür gewählt. Mit Auguste Schmidt, der Leiterin einer renommierten höheren Töchterschule in Leipzig, und Henriette Goldschmidt, die sich nachhaltig für die Reformpädagogik Fröbels einsetzte, gründete Louise Otto im Oktober 1865 den Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF) , der sich für die Bildung von Mädchen einsetzte. Ein kluger Schachzug, war doch die Kindererziehung selbst nach klassischem Rollenbild Domäne der Frau und damit nicht angreifbar. Gleichzeitig konnten sie so auch Damen des gehobenen Bürgertums erreichen, die mit konservativem Selbstverständnis explizit kämpferische Ansätze abgelehnt hätten. Mädchenbildung jedoch ging auch sie an; das klang nicht per se nach Emanzipation, nach Protest gegen die völlige Unterwerfung unter männliche Superiorität (undenkbar!). Das politische Anliegen verbrämten die drei nur durch Vagheit: „Der Allgemeine Deutsche Frauenverein hat die Aufgabe, für die erhöhte Bildung des weiblichen Geschlechts und die Befreiung der weiblichen Arbeit von allen ihrer Entfaltung entgegenstehenden Hindernissen mit vereinten Kräften zu wirken.“ Schnell bildeten sich allerorten bürgerliche Frauenvereine und begannen, Forderungen zu stellen. Dem Ehrenwort ihrem Vater gegenüber treu bleibend, konnte Marie ihnen nicht beitreten.
Sie hatte sich damit abgefunden, aber die heutige Zeitungslektüre ließ ihren Ärger hochkochen. Schlimm genug, dass Frauen bis an ihr Lebensende der Vormundschaft durch ihren Vater, später ihren Ehemann, unterstellt waren, rechtlich Kindern entsprechend, und das auch noch als unabänderliches Gesetz akzeptierten. Dass weibliche Bildung nur dazu dienen sollte, den Ehemännern zu Hause Gespräche auf halbwegs erträglichem Niveau zu ermöglichen, darüber hinaus aber keinerlei geistige Fähigkeiten oder gar eigenes Denken erlaubt waren. Wegen dieses Ideals vervollkommneter Dämlichkeit, dachte Marie grimmig, durfte an den höheren Töchterschulen des Deutschen Kaiserreichs nicht mehr als oberflächliches Wissen vermittelt werden, darum blieben Frauen vom Abitur ausgeschlossen und konnten nur in der Schweiz studieren.
Ihr stockte der Atem angesichts der Wucht, mit der die Herren der Schöpfung auf die Emanzipationsbestrebungen reagierten, mit denen Frauen nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 Teilhabe an Freiheitsrechten forderten. Sie ließ die Zeitung sinken und sah auf, als Emily, ihre Mitbewohnerin, mit der sie sich ein Wohnzimmer zwischen zwei kleinen Schlafkammern in der Pension einer geschäftstüchtigen Wirtin teilte, den Raum betrat. „Lies das“, forderte sie sie auf und streckte ihr das Blatt entgegen. „Guten Tag, meine Liebe. Welche Laus ist Dir denn über die Leber gelaufen?“ Emily nahm das Blatt entgegen. „Treitschke wieder einmal?“ Heinrich von Treitschke, Historiker und Mitglied des Reichstags, verlieh seinen Tiraden gegen Blaustrümpfe und Gleichberechtigung wirkungsvolles wissenschaftliches Flair. Seine Hetze gegen Juden hatte den Antisemitismus salonfähig gemacht. Marie schüttelte den Kopf. „Nein, heute nicht Treitschke. Schlimmer. Schau unten rechts. Virchow. Eine solche Kapazität wird Schaden anrichten.“
Читать дальше