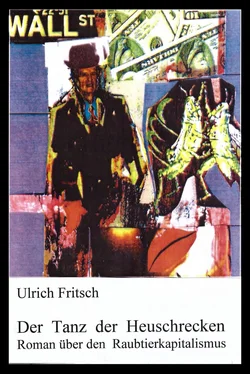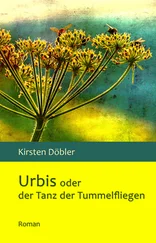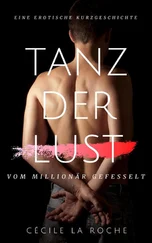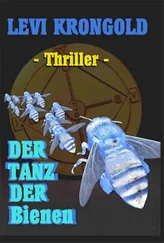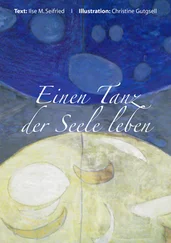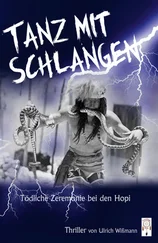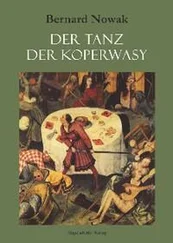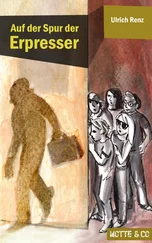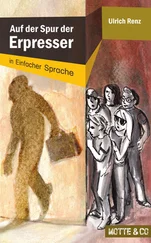„Ich weiß, was Sie denken“, fuhr Helen Laroche fort, ohne auf eine Erklärung ihres Gegenübers zu warten. „Erinnern Sie sich an die Passage in einer Anzeige, wo die publizistische Aufgabe der Banken gegenüber der Öffentlichkeit beschrieben wird?“
„Sie meinen die Stelle, in der es sinngemäß heißt: Unser kommunikatives Projekt ist der Sachverhalt. Ihn unverfälscht darzustellen, ihn nicht zu zerstören, bevor man ihn kommentiert, entspricht dem Freiheitspostulat, dem Ziel, den Konsumenten in den Stand zu versetzen, inmitten der Medien seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies setzt aber auf unserer Seite – der Seite der Manager – im Verkehr mit den Medien, der Presse, eines voraus, nämlich Offenheit in des Wortes direkter Bedeutung. Wir müssen sagen, was ist, wir dürfen nicht verschweigen oder verdecken.“
„Sie kennen den Text auswendig?“ Helen Laroche war beeindruckt.
„So gut wie. Wenn sie eine Anzeige hundertmal vorgelegt bekommen, redigieren und schließlich verabschieden, um sie dann in allen großen Zeitungen wiederzufinden, muss die Kernaussage haften bleiben. Aber was habe ich falsch gemacht?“
Helen Laroche tat sich mit der Antwort schwer. Sie setzte mehrere Male zu einer Erklärung an, blieb dann aber immer wieder in ihren Gedankengängen hängen.
„Man kann nicht direkt sagen, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Ihr Auftrag lautete, das Bild des Managers in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Man traut ihm nicht. Meinungsumfragen belegen, dass er das Image hat, der Öffentlichkeit im eigenen Interesse leicht etwas vorzugaukeln. Ihre Strategie bestand nun darin, die Absicht der Manager, mit Offenheit und Selbstkritik an die Öffentlichkeit zu treten, in den Mit
telpunkt der Kampagne zu stellen. Deshalb auch dieses Zitat.“
„Das übrigens von einem Manager stammt!“
„Mag sein. Die meisten Auftraggeber waren ja auch anfangs mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Dann aber überzeugte Emma Hengstenberg meinen Chef, dass nicht Selbstkritik der richtige Weg sei, sondern das Herausstellen positiver Leistungen. Ihre Kollegin ist Ihnen in den Rücken gefallen. Ihr Image hat eine deutliche Delle erfahren.“
Leon Petrollkowicz antwortete mit einem ärgerlichen Auflachen. „Ach, dahin läuft der Hase! Warum hat dann aber die ehemalige Mitarbeiterin Ihrer Bank, die jetzt meinen Betrieb verunsichert, meinen Vorschlag zunächst unterstützt und argumentativ unterlegt?“
„Die Betonung liegt auf ‚zunächst’. Sie hat durch eine perfekt inszenierte Intrige Ihre persönliche Zuverlässigkeit in unserem Hause in Zweifel gestellt und damit Ihre Loyalität zu Ihren Auftraggebern. Sie müssen aufpassen. Täglich erfahre ich im Speisesaal über irgendeines Ihrer Gespräche, mit denen Sie angeblich Meinungsbildner und Politiker über die fragwürdigen Praktiken der Banken und der Industrie informieren. Mal ist es die Insiderproblematik, mal die nicht uneigennützige Globalisierungsmanie, dann sind es wieder Paketverkäufe auf dem Buckel der Kleinaktionäre, unzumutbare Börsengänge und so weiter.“
Leon Petrollkowicz hörte sich die Anschuldigungen mit versteinerter Miene an. Er war als ehemaliger Journalist und Publizist von Natur aus kritisch, suchte nichts zu beschönigen oder unter den Teppich zu kehren und hatte deshalb auch eine offensive PR-Kampagne für die Wirtschaft nach dem Motto gestartet: „Wir machen Fehler, aber reden darüber und suchen nach Lösungen“. Natürlich hatte er immer wieder auf die Dissonanzen im Konzert der Wirtschaft aufmerksam gemacht, weil nach seiner Auffassung nur so das Modell Marktwirtschaft eine Chance hätte. Aber die Wirtschaft honorierte diese Art von Offenheit nicht. Sie hatte jahrzehntelang als Deutschland AG schalten und walten können wie sie wollte und mochte sich jetzt nicht damit abfinden, dass man sich von lieb gewonnenen Gewohnheiten verabschieden sollte. Diese Hengstenberg hatte natürlich seine Gedankengänge schnell durchschaut und genüsslich an entscheidender Stelle mit einem falschen Zungenschlag kolportiert. Warum war er aber ihr gegenüber so blauäugig? Männer sind offenbar zu naiv, zu geradeaus, um die Winkelzüge verkniffener Gewitterziegen zu durchschauen.
Leon Petrollkowicz blieb bis zum Ende des improvisierten Mahls einsilbig. Er dankte Helen Laroche für ihre Offenheit, die ihm vielleicht helfen könne, in Zukunft weniger vertrauensselig zu sein und sich und seine berufliche Zukunft besser zu schützen. „Wissen Sie“, sagte die so verständnisvolle junge Dame beim Aufbruch, „weshalb die Hengstenberg so unheimlich ist? Als sie eines Tages mit einem ihrer gefährlichsten Widersacher eine Besorgung für die Bank machte, kehrte sie alleine zurück. Ihr Kollege war von einem Auto überrollt worden. Die näheren Umstände, die zu dem Unglück führten, wurden nie aufgeklärt.“
„Wie beruhigend!“, sagte Leon Petrollkowicz beim Abschied.
Leon Petrollkowicz ging eigentlich recht gerne ins Büro. Er hatte vierzig Angestellte und zu den meisten ein gutes Verhältnis. Die Lage der Firma war ideal: In der Schadowpassage im Herzen von Düsseldorf, wo das Treiben nicht bunter und die allgemeine Stimmung nicht besser sein konnte. Schöne Geschäfte, nette italienische Restaurants, etliche Straßenmusikanten, kleine Verkaufsstände mit allerlei Tand, gut gekleidete Menschen. Wenn er in sein Office ging, mischte er sich gerne für Minuten unter das Volk, warf einen Blick auf die Schaufensterauslagen und ließ sich bei einem italienischen Früchtestand einen frischen Orangensaft auspressen. Weil er kein Frühaufsteher war und sich in seinem Job das meiste in den Abendstunden abspielte, ließ er es morgens langsam angehen und verlangte auch von seinen Mitarbeitern nicht die absolute Pünktlichkeit. Allerdings legte er Wert darauf, dass beim Klingeln der schnurrende Türöffner ertönte, ein Zeichen dafür, dass schon jemand da war und sich dieser gewisse Jemand mit den anderen über das Begrüßungszeremoniell verständigte. Es war fast ein Ritual, dass in der Chefetage jemand eigenhändig die Tür öffnete und man diese Tätigkeit nicht von ihm selbst oder dem Türautomaten übernommen werden musste. Die Mitarbeiter waren damit sehr einverstanden, hatten sie auf diese Weise Gelegenheit, das allmorgendliche Gelage in eine manierliche Büroszene umzugestalten. Ein Hereinplatzen des Chefs hätte unter Umständen recht peinlich sein können. Besonders Frau Hengstenberg legte Wert darauf, sich gegenüber Petrollkowicz keine Blöße zu geben. Es war eine ihrer Gewohnheiten, sich früh zur Auflockerung einen Whisky zu genehmigen, den sie freilich mit Orangensaft geschickt kaschierte. Als Frühaufsteherin nutzte sie die Morgenstunden, um private, aber auch dienstliche Telefonate zu führen, einmal, weil sie dann ungestört parlieren konnte, dann aber auch, um ihrem Gesprächspartner zu stecken, dass Leon Petrollkowicz es mit seinem Berufseifer nicht so ernst nehme, mal erscheine, mal nicht, und dass sie auf künstlerische Gepflogenheiten dieser Art halt Rücksicht nehmen müsse. Auch pflegte sie morgens den Umgang mit einigen ihr besonders sympathischen Mitarbeiterinnen, um sich so ihre Seilschaften aufzubauen. Meistens waren es vom Leben und der Liebe nicht verwöhnte Frauen, die ganz in ihrem Beruf aufgingen und sich gerne an Frau Hengstengberg anlehnten. Wenn dann in den schönsten Gesprächen der Chef klingelte, wurden die Drinks schnell weggestellt und die Plätze eingenommen. Abwechselnd öffnete immer ein anderer die Tür.
An jenem Morgen hatte eine Frau Gabler Türdienst. Sie stand für Sekunden vor ihrem Chef, murmelte ein „Morgen“, machte auf dem Absatz kehrt und ging erhobenen Hauptes in ihr Zimmer. Frau Gabler war ein Lästermaul besonderer Güte. Sie verstand es, sich immer diejenigen der Firma für ihren Schmäh auszusuchen, die bei Frau Hengstenberg ein besonders negatives Image hatten, und dies waren in erster Linie die Vertrauten von Leon Petrollkowicz. Auf diese Weise stieg sie in der Achtung ihrer Chefin und konnte sich viel herausnehmen, zum Beispiel auch, auf Fragen männlicher Vorgesetzten pampig oder überhaupt nicht zu antworten. Irgendeines der männlichen Wesen hatte ihr früher einmal ein Kind gemacht, und danach war ihr Hunger nach männlicher Zuneigung für alle Zeiten gestillt. Man erzählte sich, dass jener Liebhaber, ein Schwarzer, sie mit seinem großen Ding so erschreckt hatte, dass sie tagelang wie traumatisiert herumrannte und seitdem keinen Mann auf mehr als dreißig Zentimeter an sich heran ließ. Leon Petrollkowicz machte ohnehin immer einen großen Bogen um diese Dame, aber er hielt sie, weil sie besser als alle anderen texten konnte, und dies sogar mit leisem Humor, den man bei ihr gar nicht vermutete.
Читать дальше