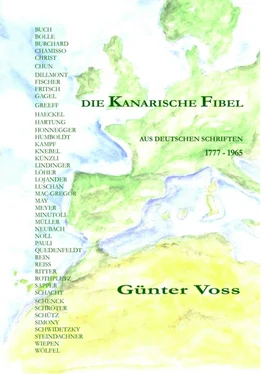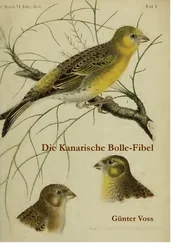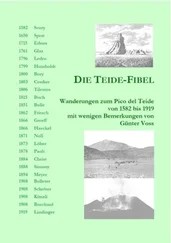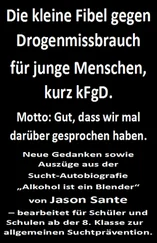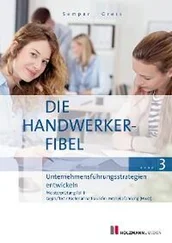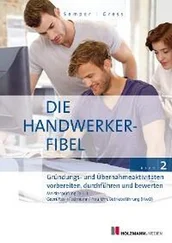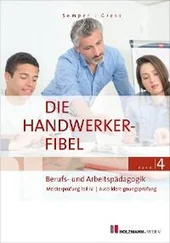1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Und dann kam das Schicksalsjahr 1826: „Im Jahre 1826 brachte die spanische Kriegsbrigg ,Soberano’ von Cadix und wahrscheinlich aus dem dortigen medicinischen Garten, drei kleine Töpfe mit Cochenille an das Consulado (damals eine administrative Behörde) in La Laguna auf Tenerife gerichtet.“ Hermann Honegger in EINFÜHRUNG UND CULTUR DER COCHENILLE. Aber bis die Cochenille sich über die Kanaren verbreitete, ging es mit dem Wein noch mehr bergab. Als 1850 die Rebenkrankheit, verursacht durch Oidium Tuckeri, auch die Kanaren heimsuchte, war der Weinbau schon so tief gesunken, dass er nur noch eine geringe Bedeutung hatte. Was davon noch übrig war, fiel dem zerstörenden Pilze anheim. Der Weinexport sank 1869 auf den Tiefpunkt von 1252 Hektoliter. 1870 belebte sich der Weinanbau wieder.
Für Francis Coleman Mac-Gregor haben die Kanarischen Inseln, „früher geschmeichelt mit dem Namen der glückseligen, an diesen Ehrennamen indessen schon seit langer Zeit alle Ansprüche aufgegeben“, wie er im ersten Satz seiner Einleitung schreibt und begründet als Göttinger Schüler dies auch beim Thema Wein. Bei der Weinernte „geht man im Allgemeinen nicht mit der Sorgfalt und Reinlichkeit zu Werke, die dabei angewandt werden sollte. Man nimmt zum Beispiel keinen Anstand, die reifen und unreifen, die guten und verdorbenen Trauben bei der Lese untereinander zu mischen. Beim Keltern verfährt man mit eben so großer Nachlässigkeit und es ist nichts Seltenes, dass man die verschiedenen Moste untereinander gießt, obgleich bei einigen bereits die Gährung eingetreten ist. Die Weinpresse oder Kelter mit ihren Zubehörungen ist gewöhnlich voll von Unrat: denn sie wird das ganze Jahr hindurch, bis man ihrer bedarf, dem Federvieh, oder Hunden und Katzen zum Aufenthalte Preis gegeben. Sie besteht in einem schlecht gezimmerten hölzernen Troge von sechs Fuß im Quadrat und zwei Fuß tief, über welchem ein Hebel von unförmlicher Dicke angebracht ist. Wenn der Trog beinahe voll ist, springen ein halb Dutzend Bauerburschen hinein und treten den Saft mit ihren bloßen Füßen aus... Die Fässer, worein man ihn füllt, werden aber vorher nicht gehörig gespült und ausgebessert; in den Weinlagern selbst sieht es oft eben so unreinlich aus und man trifft dort Dinge an, die allein schon hinreichend sind, den besten Wein im Entstehen von Grund aus zu verderben.“
Über den Geschmack des Weines - er wird ja nicht nur gehandelt, sondern auch getrunken - äußert sich schon George Glas, auch diese Urteile getrennt nach den Inseln, wie man es von dem genauen Beobachter Glas erwartet.
Lanzarote: Der Wein aber, den man davon macht, ist leicht, ohne Kraft und so scharf von Geschmack, daß ein Fremder ihn nicht vom Weinessig unterscheiden kann. Doch ist er sehr gesund. Fuerteventura bringt mehr und besseren Wein, als Lancerota.
Der Wein in Kanaria ist gut, hat aber nicht so viel Kraft, als der in Teneriffa und ist daher zur Ausfuhr nicht so tauglich. Doch schickt man jährlich viele Fässer desselben nach den spanischen Westindien.
Teneriffa: Die Weine sind stark, gut und zur Ausfuhr geschickt, besonders nach heißen Ländern, wo sie sich sehr verbessern. Man machte hier vormals eine große Menge von Malvasier oder Kanariensekt. Seit einiger Zeit aber macht man davon jährlich nicht über fünfzig Fässer. Man sammelt die Trauben, ehe sie zeitig sind und macht einen dürren, scharfen Wein davon, der, wenn er zwei bis drei Jahr alt ist, sich kaum von Madeira-Wein unterscheiden läßt. Ist er aber erst vier Jahr alt, so wird er so milde und süß, daß er mit dem Malaga-Wein große Ähnlichkeit hat Palma: Die Ostseite bringt gute Weine hervor, die aber einen anderen Geschmack und Geruch haben, wie die von Teneriffa und sehr schwer aufzubewahren sind, wenn sie ausgeführt werden, vornehmlich in kalten Ländern, wo sie leicht sauer werden.
Gomera: Der hiesige Wein ist überhaupt genommen schwach und scharf und also zur Ausfuhr nicht tauglich. Eine Art desselben aber übertrifft, wenn er zwei Jahr alt ist, den besten Madera an Geruch und Geschmack, wiewohl er so weiß von Farbe ist als Wasser und so schwach, wie Halbbier. Ich nahm einige Dutzend Flaschen von diesem Weine mit nach London, wo ich ihn einigen Leuten, als eine große Seltenheit, zu kosten gab, aber er schmeckte ihnen nicht, denn die Engländer verachten allen schwachen Wein, so delikat übrigens sein Geschmack und Duft sein mag. Die Weinhändler in Frankreich, Spanien, Portugal und einigen andern Orten, die dieses wissen, vermischen daher selbst die stärksten Weine, die sie nach England schicken, mit Branntwein.
Hierro: Der hiesige Wein ist schwach und schlecht, so daß die Einwohner sich genötigt sehen, den größten Teil desselben zu Branntwein zu destillieren.
Bei Leopold von Buch findet sich keine Bemerkung über den Geschmack des Weins und auch Mac-Gregor äußert sich nicht darüber. Bei Minutoli findet sich indirekt etwas: Sekt oder Malvasier „. wird nur an wenigen Stellen gebaut; seine Behandlung erfordert große Sorgfalt und Mühe. Es wird davon nur eine geringe Quantität gewonnen; er ist sehr teuer und nur für ein kleines Publikum bestimmt. Die Hauptausfuhr bildete der gewöhnliche canarische Landwein. Er ging zumeist nach Bremen und Hamburg, um dort mit den leichten Pfälzer-, Neckar- und Moselwein versetzt zu werden. Die Blume dieser letzteren, verbunden mit dem Feuer und der Kraft der südlichen Rebe gab den Rheinweinfabrikanten die Mittel zu glücklichen Mischungen und guten Spekulationen.“
Der Sohn eines Berliner Bierbrauers, Carl Bolle, schreibt: „Der Wein war während meines Aufenthalts auf Gomera eine wirkliche Seltenheit geworden und was davon vorhanden, so mit Brandwein, Zucker und dergl. versetzt, dass man sich durchaus kein Urteil über denselben, im unverfälschten Zustande, bilden konnte.“
Und der Schweizer Hermann Christ schwärmt: „Der Wein auf Gran Canaria ist ein sehr dunkler, fast zu milder Rotwein, während auf West-Tenerife weiße Weine und bernsteinfarbene (couleur d’ambre) vorherrschen, süß oder herb, sehr stark, aber nur hie und da das edle Aroma des Madeira bietend. Seltene Proben alter, wohl gehaltener Tenerifeweine, von dunkler Ambrafarbe, schienen mir den schönsten Madeira an Balsam und Wohlgeschmack zu übertreffen.“ Und der Deutsche Ernst Haeckel mäkelt auf Lanzarote: „Trinkbarer Wein ist auf der ganzen Insel nicht zu finden; wollen wir daher unser filtriertes Zisternenwasser schmackhafter machen, so kann dieses nur mittels Guajaven- oder Orangensaft geschehen.“ Auch die Trinkgewohnheiten wurden von den Reisenden als bemerkenswert erachtet.
„Die Bauern [Lanzarota und Fuertaventura] bilden sich sehr viel auf ihr Goffio ein und verachten die Brotesser auf den andere Inseln. Wein oder sonst irgend ein andres Getränk als Wasser, trinken sie selten. Ihr Geschäft ist Pflügen, Säen, Ernten und was sonst zum Ackerbau gehört... Nach dem Essen traktierte der Wirt die ganze Gesellschaft mit Wein, einen Becher für jede Person, welches sie beredter machte als gewöhnlich, weil dem Gesinde hier selten Wein geboten wird... Wir waren glücklich genug, auf seinem Tische, statt Goffioteiges, Brot und auch trinkbaren Wein, nebst einem Paar gebratener junger Hühner, zu finden... Dem ungeachtet sind Streitigkeiten hier nicht so häufig, als in England, welches vielleicht von den üblen Folgen, womit sie begleitet sind oder von dem Mangel der Kaffeehäuser, Weinschenken oder andern öffentlichen Häuser herrührt. Vornehmlich auch von der Mäßigkeit der Vornehmen im Trinken, ihrem höflichen Betragen und dem geringen Verkehr, welches sie mit einander haben... Die Eingeborenen dieser Inseln sind mäßig im Essen und Trinken. Würde ein Vornehmer betrunken gesehen, so wäre das ein Schandfleck seiner Ehre. Man hat mir gesagt, das Zeugnis eines Manschen, von dem man beweisen könne, daß er dem Trunk ergeben sei, vor Gericht nicht gelte. Wer daher den Wein sehr liebt, verschließt sich in seine Bettkammer, trinkt sich daselbst voll und legt sich dann zu Bette, bis er den Rausch ausgeschlafen hat.“ Glas.
Читать дальше