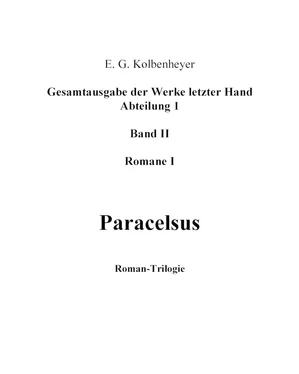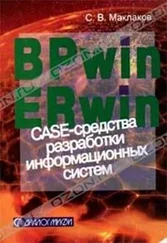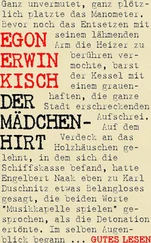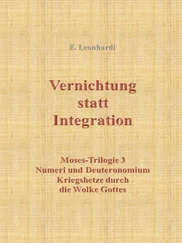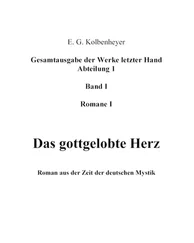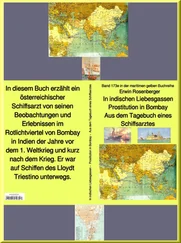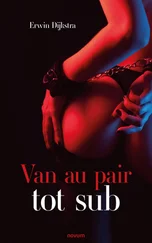1 ...7 8 9 11 12 13 ...47 Über diesen kleinen Tierkreis, der das Firmament der Gottshausleute umschloß, schwang eine bedeutsamere Zeitenfolge, die nach dem Haushalte der Gottesmutter zu Einsiedeln geregelt wurde. Alle sieben Jahre gipfelte der Gnaden Stern des großen Engelweihfestes und schüttete seine Ablaßgarben über die Pilger nieder, deren viel hundert die Gnadenkapelle umschwärmten. Aber auch in den sechs andern Jahren lief die Mühle nicht leer. Wenn nun ein Anwesen, wie das der Ochsner, an einem ihrer Hauptgänge lag und die Freiheit besaß, zu Zeiten der Pilgerflut das Rädlein auszustecken, um den Schmachtenden ein freundliches Ziel für ihres Leibes Durst und Hunger zu weisen, dann gab es dort noch andere Zeiten und Sorgen als die der sechs Kühe, der vierzehn Schafe und zweiundzwanzig Schweine.
Während das Ochsnerhaus unter dem Zeichen des Rädleins stand, war Wilhelm von Hohenheim zum erstenmal eingekehrt und hatte den günstigen Stern wahrgenommen; und während das Ochsnerhaus das Rädlein noch trug, sollte der jüngste Bombast entwöhnt werden, nachdem er sein menschliches Antlitz aus einem Zustand entwickelt hatte, der eher dem Hutzelobst der Großmutter glich als dem Ebenbild Gottes. Doch die Mutter wußte für sich und den Kleinen noch etliche Wochen der zärtlichen Hingabe abzuschmeicheln, obwohl ihre Kräfte dem Liebesopfer kaum gewachsen waren.
Er trug einen Namen, über den alle Ochsner, Weßner und Schärer nicht wenig erstaunten, als sie ihn zum ersten Male hörten.
Am schnellsten fanden sich noch die Eis und der Rudi Ochsner drein. Die Eis, weil sie dem Manne vertraute, und der Alte, weil er seit jener Nacht manchem mißtraute, worüber die andern behäbig wurden. Die Großmutter blieb besorgt. Sie fühlte, daß der sonderbare Name den adeligen Stamm des Kindes betone. Er klang wie eine Minderung des mütterlichen Blutes. Sie fürchtete für den jüngsten Bombast, weil ein guter Eidgenoß allem feindselig begegnet, was nach Ritterharnisch klirrt. Also auch Hans Ochsner, der auf das zarte Knäblein wies und meinte:
„Sehet zuo, es möcht ihn sunst einer us den Windlen blasen, so er ihn bi dem Namen ruoft.“
Darauf sagte der Vater:
„Es wird nit eins jeden Manns Gewicht uf der Metzig gewogen.“
Und der Hans:
„Sollichs ist zur Stund ein Glück vor den Metzger.“
Aber der Hans redete rauher als er tat. Er stand zuweilen an dem Körblein und schaute eratmend auf den tiefen Kinderschlaf nieder, wie man in die Ewigkeit der Berge blickt, denn auf dem Schlaf der Kleinen ruht gleichermaßen ein Schimmer der Ewigkeit.
Die Weßner schüttelten ihre fetten Köpfe und die Schärer nicht minder, sie zuckten die Achseln und zwinkerten einander heimlich zu. Nur der Klaus Weßner, dem die Angelegenheit naheging, weil er das Büblein aus der Taufe heben sollte, ließ satteln und ritt spornstreichs hinüber nach Einsiedeln. Er konnte sich nicht von dem schwäbischen Arzte, der unter die Ochsner hineingeschneit war, zum Fatzmann machen lassen und wollte wenigstens der Würdigkeit des Heiligen versichert sein, nach dem das Patenkind heißen sollte. Daß ihn der Propst und Pfleger, Herr Diebold, und, wenn er darauf bestand, auch der Fürstabt, Herr Konrad, wohlgeneigt empfangen würden, dessen war er sicher. Mit dem Kloster stand es trotz aller himmlischer Gnaden nicht glänzend, und Klaus mußte zu Zeiten der Engelweihe das Marmelschloß seiner Geldkiste aufspringen lassen, sonst wäre das einträgliche Fest übel eingeleitet gewesen.
Herr Diebold empfing ihn mit freundlicher Hast, er bedurfte gerade kein Geld. Aber der erhitzte Klaus Weßner wurde dringlich und zeigte durchaus die unbefangene Art des klügeren Wirtes. Er war nicht damit abgetan, als der Propst versicherte, einen heiligen Theophrast gäbe es in keiner Litanei. Klaus wünschte, daß irgend etwas Schriftliches eingesehen werde. Schwarz auf weiß, das war guter Grund. Herr Diebold gab nach und fuhr mit dem Finger über etliche Pergamentblätter. Klaus sah scharf darauf, daß der Finger keine Zeile übersprang, er wollte seiner Sache vor Hohenheim gewiß werden, und selber lesen konnte er nicht.
Die Allerheiligenlitanei behielt recht; in der alleinseligmachenden Kirche lebte kein Theophrast, weder unter den Heiligen noch unter den Ketzern.
Klaus blieb also ungestillt. Er fragte, was der verdächtige Name eigentlich bedeute, denn auf Schwyzer Boden war er unerhört. Herr Diebold fand sich aufs peinlichste bedrängt.
„Wer viel fraget, geht als ouch viel irr, Weßner.“
„Allein darab hanget des ohnschuldgen Kindli Seelenheil, daß ihme ein getrüer Fürbitter sije. Dann soll ihm zum jungisten Tag nit jedlicher Fürbitter von der Hand weisen und fragen: nach welichem heißest du, daß er dich für Gott kunnt us dem Drecke ziehn, darin din arme Seel steckt.“
„Item, lieber Weßner, wir hänt do bewiesen, daß es kein heiligen Theophrastum nit gibt. – Der selig Markgraf zu Brandenburg ward als ouch Achill geheißen, und sin Sohn wird Cicero genennt. Hat glichermaßen nindert ein heiliger Achilles noch Cicero gelebt. Gebet Üch zefrieden. Es ist des Vaters Recht, daß er sin Kind benamset. – Dieweil aber ein heiliger Theodorus, Theodosius, Theodot, Theodulus, Theonas, Theokar und Theonestus für Gott bestehet, wird der Theophrastus ouch kein ghürnter Drach oder Leviathan gewest sin … von dem der heilig Benno sagt: Ecce draco magnus et rufus, propter sanguinem Martyrum!“
Das Latein des heiligen Benno tat endlich sein Gutes. Es erstickte die Zweifel und führte den Klaus in die Schranken der Ehrfurcht zurück, die dem Laien nun einmal gebühren, und wäre er gleich der trefflichste Hauswirt.
„Hochwürden Herr Prior vermeinet als demnach mit nichten …“
„Ziehe in Frieden, min Lieber, so das Knäbli vom Herzen ist wohlgeschickt und erfreulich, möcht ihm des Luzifer Namen nüt sorglich werdin.“
Herr Diebold atmete auf, als er des Fragers ledig war. Doch an das Seufzerlein der Erleichterung schloß sich ein gewichtigeres des Unfriedens.
Durch sein Guckfenster sah er jenseits des kräftig jungen Grüns der Au aus dem Walddunkel der Höhen die steilen Mythen ragen, noch hell beschneit, aber das lenzbewegte Gewölk flog darüber hin.
Von der Oberpfalz, vom Reichenbacher Kloster, war im Herbst der Ordensbruder Nikolaus de Donis eingekehrt und weiter nach Basel zu dem gelehrten Drucker Amerbach und zu Sebastian Brand gereist. Er kam über Ingolstadt, wo er geistbewegte helle Stunden mit Hieronymus von Croaria, Sixtus Tücher und dem jüngstberufenen Celtes genossen hatte. In göttlicher Trunkenheit glühten die Augen des Bruders, als er von jenen Stunden sprach. Und nach ihm fiel die Mooröde der Abtei über Herrn Diebold, und er lag lange in harten Zweifeln.
Was er in seiner Jugend schwer erstickt hatte, war wieder aufgerührt und stand in Flammen. Diese Flammen aber zernagten das leidige Wetterdach seiner verzichtenden Heiterkeit. Mußte der feiste Bauer da an dem ersten gebenedeiten Frühlingstag in seine Zelle dringen, um ihm zu zeigen, daß er sein Pfund verlottert habe! Vor einer Woche erst war ein Brief des Bruders Nikolaus zu ihm gelangt. Dessen letzte Weisheit stand wohl nicht auf dem engbeschriebenen Zettel, und eine Nachricht, die alle Gelehrten dieser Tage mächtig bewegte, die Nachricht, daß Max I. Reuchlin in den Adel, ja zum Pfalzgrafen ehestens erheben werde, hatte Herrn Diebold kalt gelassen – aber der Brief war in einem Latein geschrieben, das den Pfleger von Einsiedeln befing wie Wein, der prickelnd und duftend über die Zunge fließt. Wer solch ein Latein schrieb, besaß Weihe, für die er keine äußeren Zeichen brauchte. Herr Diebold wußte: in Basel, selbst im nahen Zürich lasen sie die Alten in ihrer Sprache, Griechen und Lateiner, und mehr noch, sie lasen die Heilige Schrift im Urtext. Sie hatten Schlüssel und brauchten der Pförtner nicht. Allenthalben in den deutschen Ländern brachen hellsprudelnd die Quellen eines neuen Wissens aus. Und warum schrieb ihm Nikolaus de Donis, ihm, dem Prior und Pfleger von Einsiedeln, der vor der Zeit vermooste? Weshalb hatte der weitgereiste, hochgelehrte Mann ihm damals das Herz erschlossen? Er warb um ihn! Sie wollten, daß er in ihrem lichten Kreise lebe.
Читать дальше