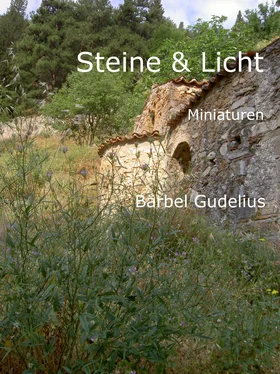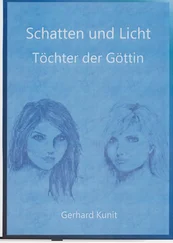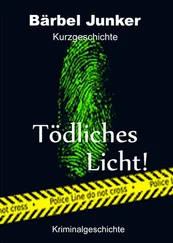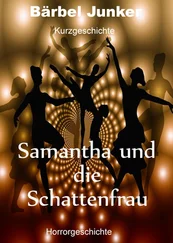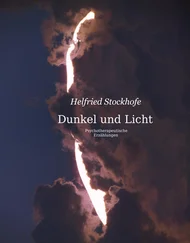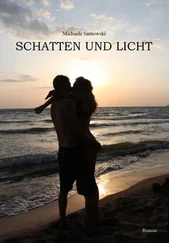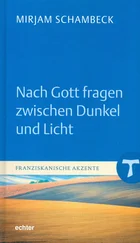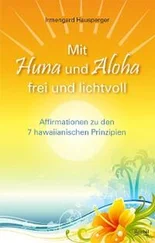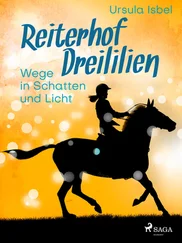Diese Bräuche dienten letztlich zur Rechtfertigung der Eroberung und Versklavung der indigenen Völker durch die christlichen Eroberer, wobei sie, wie vermutlich alle ihre Zeitgenossen und wie fast alle Menschen zu allen Zeiten, keine Parallele zu ziehen fähig waren zwischen den Menschenopfern auf den Altären und den Opfern, wir benutzen das Wort immer noch und gerade hier, die ein Krieg fordert, und so ausgedrückt, scheint der Krieg ein Gott zu sein, der Opfer genauso fordert wie Huitzilopochtli.
In Tlatilco schufen Töpfer Totenmasken, die zur Hälfte das Gesicht eines Lebenden und zur anderen Hälfte das eines Toten zeigte. Sind nicht Leben und Tod zwei Seiten einer einzigen Wirklichkeit? und haben diese Menschen das verstanden? Der Opfertod wurde „Blumentod“ genannt - ein genauso ehrenvoller Tod wie der auf dem Schlachtfeld; ein natürlicher Tod durch Krankheit oder Alter wurde als nicht ehrenvoll betrachtet. Auch das ist etwas, was uns nicht ganz fremd ist; wir glauben heute, es überwunden zu haben, aber ist das so?
Vor mir liegt die Fotografie einer Skulptur: ein oltekischer Steinkopf. Der fast runde Kopf hat zwei Hälften: die rechte Seite zeigt das Gesicht eines Menschen, ein schmales, sichelförmiges Auge, eine halbe Nase einen halben Mund, eine Wange. Die linke Hälfte des Gesichts ist nicht herausgearbeitet; aber der Stein ist auch nicht grob belassen, sondern geglättet, sodaß sich diese Seite wie eine Maske vor das halbe Gesicht zieht. Diese Glättung und die Anpassung des Steins an die Rundung des Kopfes zeigt, dass es keine halbfertige Arbeit ist, sondern etwas, was den Totenmasken in Tlatilco entsprechen könnte: das halbe Gesicht des Menschen. Denn die andere Hälfte ist weltabgewandt, nicht sichtbar, einem Reich zugewandt, von dem wir nichts wissen, auch meist lieber nichts wissen wollen.
Aber jene Menschen haben etwas davon verstanden, dass der Tod die andere Seite des Lebens ist. Er war so sehr ein Teil ihres Lebens, dass sie es ausdrücken konnten in einem halben Gesicht.
Und hat der Schrei „Viva la muerte“ der spanischen Faschisten vielleicht etwas damit zu tun, dass aus diesem indigenen Bewußtsein etwas übergegriffen hat auf den Eroberer?
Die Wahrheit des Lebens ausdrücken
Die Fahrt ging nach Norden, vom Finnischen Bahnhof aus. Wir ließen die Stadt hinter uns, die Megastadt mit ihren Plätzen und Palästen, mit ihren Straßen wie Kanäle und ihren Kanälen wie Straßen, mit ihren Hinterhöfen und Kaufhäusern, ihrer klassizistischen Strenge und den Golddächern der Basiliken, mit ihren U-Bahn-Schächten und Rolltreppen. Wir fuhren nach Norden, eine Fahrt von einer knappen Stunde; die elektritschka war voll, fliegende Händler mit Plastiktaschen, die ihre kleinen, transportablen Waren anpriesen, Musikanten, die traurige russische Weisen auf ihrem Akkordeon spielten und in ihrer Mütze Geld einsammelten, um dann in den nächsten Wagen weiterzuziehen - marginale Existenzen, wie leben solche Leute?
Dann lagen auch die Vororte hinter uns, das Land begann. Nicht sofort, die elektritschka fuhr nicht schnell, allmählich erschienen die Birken, vereinzelt zunächst, dann in kleinen lichten Wäldchen, sie spiegelten sich in moorigen Tümpeln, hier konnte man sehen, worauf St. Petersburg gebaut worden war, auf schwarzem schwankendem Grund, auf Moor und Sumpf.
Und auf den Knochen von Tausenden von Leibeigenen, von adligen Herren dem Zaren zur Verfügung gestellt, die seit 1703 in wenigen Jahren die Wälder der Umgebung in die Sümpfe trieben, auf dass Peter I. sein Tor nach Westen öffnen konnte. Peters Denkmal, der Reiter auf dem steigenden bronzenen Hengst, so berühmt wie er selbst, der mit ausgestrecktem Arm nach Westen deutet, steht an der Newa. An die Leibeigenen erinnert nichts.
Kleine Bahnhöfe, Stationsschilder in einer fremden Schrift. Dennoch stiegen wir richtig aus: Repino. Zwei blutjunge Polizisten, die sich offensichtlich langweilten und entzückt waren, uns weiterzuhelfen, wiesen uns, mit der Sprache der Hände und unsererseits dem Verstehen einiger russischer sowie internationaler Wörter wie ‚Bus‘ den Weg zur Bushaltestelle. Drei Stationen, und da waren wir: im Haus des Malers Ilja Repin. Heute Museum.
Es ist ein sehr eigentümliches Haus, Repin hat es selbst entworfen, oder vielmehr: er hat es wie ein Schneckenhaus um sich herum gebaut. Ich habe keinen Grundriss; einzig daraus könnte man die Struktur dieses Hauses erkennen: man tritt vom Flur aus, nachdem man Filzpantoffeln übergezogen hat, in einen Wohnraum, an den ein kleines Zimmer grenzt, eine Garderobe oder ein Dienerzimmer; die Wohnräume der Familie liegen hinter diesem ersten Raum hintereinander, in einer Art von Rundbau, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, eine vorgebaute verglaste Veranda, das Esszimmer.
Man darf nicht vergessen, dass Repin noch in einer Zeit lebte, in der Dienerschaft selbstverständlich war, ja, unumgänglich, da die gesamte Hausarbeit von der Hausfrau allein nicht zu schaffen war. Bei Repin jedoch herrschte ein eigentümlich demokratisches Prinzip: bei Tisch wurde nicht bedient. Im Esszimmer steht er noch, der wuchtige runde Tisch mit dem drehbaren Aufbau in der Mitte, auf dem die Speisen und Getränke standen: jeder Gast, und es gab immer viele Gäste, drehte die Scheibe, um sich von den Speisen selbst zu nehmen. Wer so unvorsichtig war, um das Brot oder die Butter, den Wein oder die Sauce zu bitten, wurde dazu verurteilt, auf einer hölzernen Kanzel fast unter der Decke, zu der eine Treppe hinauf führte, eine Rede zu halten. Im Laufe der Zeit saßen an diesem Tisch wohl alle Petersburger, deren Namen etwas galt, unter anderen Maxim Gorki mit seiner Frau, Fjodor Schaljapin, Wladimir Majakowski, Lew Tolstoi, um nur einige zu nennen. Es war eine originelle und sehr individuelle Form eines alternativen Lebens, wie es das nach der Jahrhundertwende in ganz Europa gab: Versuche, der bürgerlichen und spießbürgerlichen Vorherrschaft zu entkommen, häufig verbunden mit dem Umzug und Rückzug aufs Land; Landkommunen entstanden mit Versuchen, die wir heute biologischen Anbau nennen, das große Vorbild in Russland war natürlich Tolstoi, Graf und Bauer.
Ilja Repin, 1844 geboren im Gebiet Charkow, verließ die Großstadt, verließ 1900 Russland und ließ sich jenseit der damaligen Grenze am Finnischen Meerbusen nieder. Denn damals war das hier Finnland. Wenn man sich die Karte anschaut, verlief die damalige finnisch-russische Grenze knapp hinter Petersburg und teilte den Ladoga-See in zwei Teile. Im Jahre 1918, nach dem Sieg der Revolution, wurde die Grenze geschlossen. Repin wurde finnischer Staatsbürger.
Das Haus, das er mitten in ein Waldstück baute, etwa 100 Meter vom Meer entfernt und geschützt vor den Winterstürmen durch ein paar Kiefernwäldchen auf niedrigen Dünen, nannte er Penaten, nach den alten römischen Haus- und Schutzgöttern. Es wurde sein ständiger Wohnsitz bis zu seinem Tod.
Das Haus ist ein Rundbau mit Ecken - anders kann man es nicht beschreiben. Niedrige Räume mit weißgestrichenen Holzdecken und Fensterrahmen, vor den Fenstern weiß Voile-Vorhänge - das Weiß bewirkt, dass die Räume, obwohl sie klein und niedrig sind, weiträumig und groß wirken.
Alles, so hieß es, sei wie zu Lebzeiten Repins wieder hergerichtet worden, nachdem das Haus im Krieg abgebrannt ist. Auch das Atelier im 1. Stock mit Sofa, Staffeleien, Pinseln in Töpfen, Paletten, Farben, Fotografien von einigen seiner Gemälde im ganzen Haus, Originale wären hier zu gefährdet und ohnehin sind sie verstreut weltweit in Museen.
Und ringsum lichter russischer Wald, Birken, Kiefern. Wege, die wir gehen und die Repin gegangen ist, mit seinen Freunden, mit seinen Kindern, mit seiner Lebensgefährtin, der Schriftstellerin Natalia Nordmann. Rasen unter den Bäumen. Eine kleine Brücke über einem Graben, weiß gestrichenes Geländer.
Читать дальше