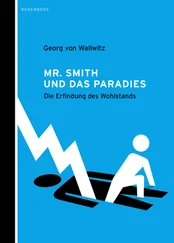Die Hitze des Tages kam mir gerade recht für einen Ausflug in den Norden der Stadt zur Tochai- Talstation, von der aus eine Seilbahn in die kühle Bergwelt führte. Auf diese Tochai-Bergbahn halten sich die Iraner viel zugute, denn wenn man ihrer Tourismuswerbung glauben konnte, war sie mit über sieben Kilometern die längste und mit ihrer Endstation auf fast viertausend Metern auf dem Mount Tochai auch die höchste Seilbahn der Welt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, dass die Seilbahn wegen Reparaturarbeiten geschlossen war. Anatol zuckte mit dem Schultern und sagte, in Teheran sei alles Interessante entweder zu teuer oder geschlossen. Er konnte sogar mit einem Witz aufwarten. „Was haben die Tochai-Bahn und die U-Bahn von Teheran gemeinsam?“ fragte er. „Sie werden erst fertig, wenn der letzte Imam erscheint. Hahaha.“
Ich blickte mich um und sah von der Talstation am Rande der Berge auf ein Häusermeer, das den gesamten Horizont erfüllte und dessen südliche Ränder im Dunst verschwammen Ein Tal aus Stein, ein Kessel voller Lebensdampf, der das ganze Land in Atem hält. Irgendwann werde ich diese Stadt auch einmal von den Höhen des Tochai-Berges aus sehen, dachte ich, wenngleich nicht heute.
Wieder holte Anatol seinen Campingkocher aus dem Wagen und bereitete neben der geöffneten Wagentüre einen Instantkaffee zu. Ich blickte auf meine Stadtkarte und beschloss, in das Grabmal Ayatollah Chomeinis im Süden der Stadt zu besuchen.
Anatol winkte ab. „Zu weit“, sagte er.
„Na und?“ fragte ich. „Ich habe Zeit.“
„Außerdem nicht fertig“, fügte er hinzu. Er hatte erkennbar keine Lust, in den Süden zu fahren.
„Davon will ich mich selbst überzeugen.“
„Kein Benzin mehr.“
„Dank tank doch“, gab ich zurück. Gottlob hatte ich die Tagestour nicht im voraus bezahlt.
Tatsächlich benötigte Anatol mit seinem altertümlichen Taxi eine geschlagene Stunde, ehe er den Süden der Stadt erreichte. Mehrfach verfuhr er sich, passierte zweimal eine Einbahnstraße und zeigte deutliche Zeichen von Ungehaltenheit. Ich notierte: Der Armenier ist nicht unbedingt der geborene Dienstleister. Aus dem Radio erklang iranische Popmusik, ein sehr rhythmisches Lied mit hammerartiger Schlagzeugbegleitung und einer Frauenstimme, die sich so schrill anhörte, als würde die Sängerin während ihres Vortrages gewürgt. Im Unterschied zum Norden boten die Straßen im Süden Teherans einen heruntergekommenen Anblick. Viele Häuser wirkten baufällig, selbst wenn sie erkennbar neu waren. An den Straßenrändern türmte sich der Abfall neben ärmlichen Märkten, immer wieder behinderten große Schlaglöcher den Verkehr. Wir durchfuhren die Armenviertel der Stadt, jene Bezirke, aus denen im Revolutionsjahr die notleidenden Massen aufgebrochen waren, um die Mullahs im Kampf gegen den Schah zu unterstützen. Wenn man sich heute auf den Straßen umsah, hatte es ihnen wenig genutzt.
Die Mittel, die man für die Sanierung des Südens hätte aufwenden können, hatte die Stadtverwaltung in das Ayatollah Chomeini-Grabmal investiert. Für umgerechnet nicht weniger als zwei Milliarden Dollar war in der Nachbarschaft des Teheraner Friedhofs Behescht-e Zarcs ein gewaltiger Baukomplex entstanden, der neben der Grabmoschee mehrere Innenhöfe, Einkaufszentren, Hospitäler und Tagungsstätten für Zehntausende Besucher täglich umfassen sollte– wenn er denn endlich fertig würde. Immerhin war das Konzept bemerkenswert: ein Ort des Todes und des Lebens zugleich, was für das Weltverständnis der Schia charakteristisch ist. Denn kaum eine andere Religion leitet ihre Lebensregeln derart ausschließlich aus der Erinnerung an Tote ab wie der schiitische Islam, was ihn von der Sunna, der Mehrheitsrichtung des weltweiten Islam, unterscheidet.
Sunna (Überlieferung) und Schia (Partei), die beiden großen Glaubensrichtungen des Islams, unterschieden sich anders als Katholizismus und Protestantismus im Christentum oder Hinayana und Mahayana im Buddhismus in theologisch-liturgischen Fragen kaum voneinander. Für beide Richtungen ist der Koran das geoffenbarte Wort Gottes, an dem kein Jota geändert werden darf. Beide Richtungen orientieren sich an den fünf Geboten des Islam (Anrufung Allahs, Pilgerfahrt nach Mekka, Mildtätigkeit gegen Arme, das fünfmalige tägliche Gebet und die Feier des Ramadan). Abgesehen von rituellen Kleinigkeiten trennt Sunna und Schia allein die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Nachfolge Mohammeds.
Die Sunniten, zu denen 90 % der Mohammedaner gehören, orientieren sich in dieser Frage an der Überlieferung. Alle strittigen Fragen sollen durch Schriftgelehrte entscheiden werden, die ihren Rang allein durch Weisheit und ein vorbildliches Leben erhalten. Was die Nachfolge des Propheten betrifft, so soll der „Würdigste“ zum Führer, zum Kalifen („Stellvertreter“) , ernannt werden. Diese Methode der Designation ist dem arabischen Denken tief verwurzelt. Eine Ernennung allein aufgrund von Blutsverwandtschaft ist dem Araber fremd.
Die Schia ist die „Partei“ Alis, des Schwiegersohns des Propheten. Ali hatte Fatima, die Tochter des Propheten geheiratet und mit ihr zwei Söhne, Hassan und Hussain, gezeugt. Nach der Lehre der Schia kann nur ein Verwandter beziehungsweise ein Nachfolge Mohammeds Kalif werden. Trotzdem wurden die ersten drei Kalifen Abu Bakr, Omar und Uthman per Wahl bestimmt. Ali, der Schwiegersohn des Propheten, kam erst als vierter Kalif im Jahre 656 zum Zuge, wurde aber schon kurz darauf ermordet. Alis jüngerer Sohn Hussain unterlag 680 dem Omayyaden Yazid in der berühmt-berüchtigten Kamelschlacht von Kerbela. Sein Kopf wurde auf eine Lanze gespießt und in Damaskus zur Schau gestellt. Allen Schiiten gemeinsam ist, dass sie seitdem dieser märtyrerhaften Ursprünge, vor allem dem Tod Hussains, in aufwendigen Formen gedenken. So entstand ein Kult des Todes, den man im Dienst der richtigen Sache mit Freuden auf sich nehmen sollte, außerdem eine Geringschätzung des Staates, der gegenüber den Weisungen der Imame (in der Schia immer ein Nachfolger des Propheten) keine eigene Wertigkeit besitzt.
Innerhalb der Schia unterscheidet man zwei Hauptgruppen, die sich beide auf Hussain, den dritten Imam, zurückführen und sich allein der Auffassung unterscheiden, wann der vorletzte Imam verschwand. Nach der Lehre Siebener Schia oder der Ismaeliten starb Ismael, der Sohn des 6. Imam, vor seinem Vater. Damit endete die Zählung der Siebener Schia- Die Zwölfer- Schia erkannte dagegen Ismaels jüngeren Sohn Mohammed als 7. Imam an und führte die Linie weiter bis zum Jahre 873, dem Todesjahr des 11. Imams. Seitdem warten die Schiiten dieser Glaubensrichtung auf den Imam Mahdi, den 12. Imam, der im Verborgenen weilt und eines Tages wie ein Messias wiederkehren wird, um die Welt zu retten.
Die Stunde der Siebener-Schia schlug, als sie das Kalifat der Fatimiden in Ägypten gründeten und den Maghreb missionierten. Die Zwölfer-Schia betrat die Bühne der Weltgeschichte, als es den Safaviden am Beginn des 16. Jahrhunderts gelang, von der Osttürkei aus den Iran zu erobern und die Lehre der 12er Schia zur Staatsreligion zu erheben. So kompliziert sich diese Vorgeschichte und Terminologie auch anhört, ohne die Mythen vom Märtyrertod Hussains, vom Kampf gegen den ungerechten Kalifen Yazid und der Lehre vom letzten Imam, ist der spirituelle Hintergrund der iranischen Revolution nicht zu verstehen.
Als mich Anatol vor dem Mausoleum Imam Chomeinis auslud, befand sich der Komplex noch im Bau. Überall ragten Baukräne in den Himmel, zwei der vier Minarette waren von Gerüsten umgeben. Aber der Grundriss der Anlage war bereits erkennbar. Zwischen den vier je 91 Meter hohen Minaretten erhob sich die 68 Meter hohe Grabkuppel. 91 Meter hoch waren die Minarette, weil diese Zahl dem Alter des Chomeinis in Mondjahren entsprach, und die die Höhe der 68 Meter hohen Kuppel bezog sich aus das Jahr 1368 der islamischen Zeitrechnung, das dem Jahr 1989 entsprach, in dem der Imam kurz nach dem Ende des iranisch-irakischen Krieges gestorben war. Ganz im Unterschied zu dem gnadenlosen Image, das Chomeini im Westen besitzt, hatte sich der Ayatollah eine Grabstätte gewünscht, an der es den Menschen möglich sein solle, sich zwanglos zu treffen und zu entspannen. Und wirklich saßen auf den Wiesen rund um das Mausoleum Familien vollkommen ungezwungen beim Picknick, hier und da hörte ich iranische Popmusik aus Kassettenrecordern, diesmal allerdings kämpferische Männergesänge zum Rhythmus stampfender Soldatenschritte. Sogar im marmorausgeschlagenen Innern des Chomeini-Grabmals spielten die Kinder Nachlaufen und liefen kreischend über die Teppiche, während ihre Mütter in den kleinen Nischen der großen Halle saßen und ein wachsames Auge auf den Nachwuchs hatten. Den Jungen war anzumerken, wie verwöhnt sie wurden, aber die kleinen Mädchen, die noch nicht verschleiert waren, hielten kräftig mit. Der Zugang zum eigentlichen Schrein war nach Männern und Frauen getrennt. Die sterblichen Überreste des Ayatollahs ruhten in einem bescheidenen Grab, das durch ein Gitter von der großen Halle abgetrennt war. Bündel voller Banknoten, die die Pilger durch die Gitterstreben auf das Grab warfen, lagen neben dem Sarg. Große Kühlvorrichtungen an der Decke erzeugten eine so angenehme Temperatur, dass sich Dutzende Männer nach dem Besuch des Grabes auf die Teppiche legten und schliefen. Ein unablässiges Kommen und Gehen beherrschte die Halle, ein Tuscheln und Wispern, halb erregt, halb begeistert, das wie das Rauschen eines Baches durch die Halle tönte. Hier lag der große Tote, der die Welt verändert hatte und dessen Bewertung die Menschen bis auf den heutigen Tag entzweit. Mir imponierte die alttestamentarische Wucht, mit der er seine Ziele unbeirrt verfolgt hatte, seine Bedenkenlosigkeit und unmenschliche Konsequenz aber stießen mich ab. Vielleicht musste man den Ayatollah, um ihn moralisch richtig einzuordnen, mit anderen großen Figuren seiner Zeit in Beziehung setzen. Auch Nelson Mandela hatte unter dem Apartheidsregime in Südafrika schwer gelitten, doch als er die Macht übernahm, wurde er zu einem Gnadenmann, dem es gelang, das alte und das neue Südafrika so miteinander ins Gespräch zu bringen, dass die Ströme von Blut vermieden wurden, die allseits erwartet worden waren. Auch der Dalai Lama saß nun schon über ein halbes Jahrhundert im indischen Exil und sollte er jemals in Tibet die Macht übernehmen, wären keine Gemetzel zu erwarten, wie sie die Machtergreifung der Mullahs begleitet hatten. Chomeinis Anhänger würden solche Vergleiche unpassend erscheinen. Mandela und der Dalai Lama waren für sie nur „Kuffar“, Ungläubige, deren Geschick sie nicht interessierte. Ihnen ging es nur um ihre eigene Wahrheit, und dieser monumentalen Gestalt, die dieser einen Wahrheit mit Gewalt gegen alle andern Auffassungen zum Sieg verholfen hatte, gehörte ihre ganze Liebe.
Читать дальше