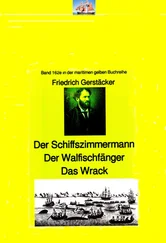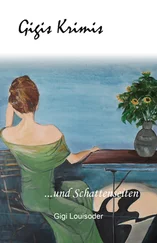(lacht) Es ist immer etwas von meinen Lebenserfahrungen drin – also schnarche ich auch. Ich habe natürlich als Schauspieler das Schnarchen gespielt, aber meine Frau hat mir versichert, dass ich es nicht nur spiele. Sie und meine Tochter haben es sogar mit dem iPhone aufgenommen, damit ich es glaube. Ich glaub’s nicht.
Sie waren fast 20 Jahre lang „Stubbe“ und als der ein ausgesprochener Publikumsliebling – Anfang Januar hatte die Wiederholung einer Folge um 21.45 Uhr über fünf Millionen Zuschauer, das ist phänomenal. Warum haben Sie eigentlich damit aufgehört?
Ich habe ja nie nur „Stubbe“ gedreht, sondern auch Komödien wie „Job seines Lebens“, dramatische Geschichten wie „Bis zum Horizont und weiter“ oder „Eine Liebe in Königsberg“. Aber eine Reihe wie „Stubbe“ deckt nun mal alles andere sehr stark zu. Auch das war für mich mit ein Grund zu sagen: Wenn’s am schönsten ist, sollte man aufhören. Ich wollte den Erfolg, aber auch die Gunst der Zuschauer nicht aufs Spiel setzen, indem ich immer nur sage: Ach, machen wir einfach immer weiter, es läuft doch so gut. Aber seien Sie beruhigt: Ich werde jetzt nicht von einer Quizshow zur nächsten Kochsendung reisen.
Sie sind hier in Dresden aufgewachsen und leben noch immer hier. Gibt es abseits der Touristen-Hotspots wie Zwinger, Semperoper oder Frauenkirche Orte in der Stadt, an denen Ihr Herz besonders hängt?
Wenn sie mir zwei Seiten Platz geben, zähle ich sie auf. Aber es gibt für mich auch Orte der Erinnerung: Hier bin ich zur Schule gegangen, dort habe ich Kabarett gespielt, das Amateur-Arbeitertheater, hier habe gearbeitet als Schweißer oder Lehrmeister. Und als wir „Blindgänger“ auf dem Flughafengelände im Ortsteil Klotzsche gedreht haben, war für mich meine Jugend wieder da, denn in Klotzsche bin ich aufgewachsen.
Aufgewachsen sind Sie als Einzelkind und ohne Vater . . .
Ja, als Schlüsselkind. Mein Vater ist aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Er hat mich nie gesehen, und ich habe ihn nie gesehen.
Als Sie hier aufgewachsen sind, sah Dresden völlig anders aus als heute, nämlich komplett kriegszerstört . . .
Ich bin ja am Stadtrand von Dresden aufgewachsen, wo es diese Zerstörungen nicht so gab. Für mich als Kind gehörten die Kriegswunden einfach zum Stadtbild. Ich konnte später mit ansehen, wie sich aus einem kaputten Nichts etwas entwickelte.
Und heute? Ist Dresden schöner denn je?
Dresden war schon vor dem Krieg eine traumhaft schöne Stadt. Heute bin ich einerseits froh, wie der Neumarkt rund um die Frauenkirche wiederaufgebaut wurde, auf der anderen Seite erschrecken mich Bausünden wie auf dem Postplatz, der eigentlich ein Schrottplatz ist. Was da im Blickfeld des barocken wunderschönen Zwinger an Eisen und Unsinnigkeiten verbaut wurde … Dennoch: Ich liebe meine Stadt und ihre Umgebung: Um die Ecke ist die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge, Meißen mit seinem Dom, die Moritzburg, das Jagdschloss von August dem Starken. Dafür müssen andere Menschen Flugreisen unternehmen, wir haben es vor der Tür.
Dresden macht seit einiger Zeit ganz andere Schlagzeilen – durch die Pegida-Demonstrationen. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das?
Es ist einfach eine Pflicht, Not leidenden Menschen, ganz gleich welcher Herkunft oder Glaubensrichtung, zu helfen. Diese Stadt und dieses Land gehören uns nicht alleine, uns gehört nur diese Erde. Deshalb finde ich jede Form von Ausländerfeindlichkeit egoistisch, engstirnig und kleinbürgerlich. August der Starke hat schon 1697 etwas gesetzlich festlegen lassen, das sich die Sachsen heute noch einmal in Erinnerung rufen sollten: „Im Kurfürstentum sei es jeglicher Person freigestellt, woher sie auch kommen möge, der Konfession nachzugehen, wonach ihr wohlhochlöblich geziemt.“ Auf der anderen Seite muss man die Ängste und Unsicherheit der Menschen ernst nehmen, nicht verteufeln.
Und dennoch gehen hier in Dresden 20 000 Menschen und mehr auf die Straße, wenn Pegida zu ihren Demonstrationen aufruft.
Die Leute laufen ja mit den unterschiedlichsten Motiven dahin, dahinter steckt eine weitverbreitete allgemeine Unzufriedenheit. Der eine kann nicht begreifen, warum in einem Dorf mit 170 Leuten 75 Flüchtlinge untergebracht werden sollen, der andere hat vielleicht von einer Straftat gehört, die ein Ausländer begangen hat, und vergisst, dass es überall gute und schlechte Leute gibt. Der eine hat vielleicht Sorge um seinen Arbeitsplatz, der andere um seine Rente.
Haben prominente Dresdner wie Sie Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen?
Das habe ich immer schon getan. Und es wurde jetzt auch Zeit, dass diejenigen, die in Dresden etwas zu sagen haben und keine politischen Ämter bekleiden – Künstler, Bildungsbürger und andere – Flagge zeigen und den Mund aufmachen, dass unsere Zukunft nicht in Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Intoleranz liegt, sondern in Weltoffenheit.
Herr Stumph, in einem Jahr werden Sie 70. Haben Sie so etwas wie Ruhestandsfantasien, oder wird das Publikum Sie noch lange erleben?
Ich bin nicht im Ruhestand, sondern ich bleibe im Unruhestand. Der nächste Film ist in der Endproduktion und heißt „Insassen“. Darin spiele ich einen Finanzmanager, der nach einem Nervenzusammenbruch in der Klinik gelandet ist. Seine Situation als Patient hat er allerdings noch nicht verinnerlicht. Stattdessen versucht er, seine „Station 4“ als Premiumanbieter der gehobenen Burn-out-Therapie an die Börse zu bringen.

Wolfgang Stumph. (Imago/Sven Ellger)
Hier tappen sogar Lehrer in die Falle
Diktatwettbewerb: Als Redakteur im Selbstversuch
Von Rainer Lahmann-Lammert
Verdammt, heißt es „herumkrakeelen“ oder „herumkrakelen“? Das ist noch eine der einfachsten Fragen, denen ich mich beim großen Diktatwettbewerb „Osnabrück schreibt!“ der Friedel-&-Gisela-Bohnenkamp-Stiftung stelle. Als einer von 70 Teilnehmern versuche ich in der Kunsthalle Dominikanerkirche den Zweifelsfällen und Fallstricken zu entgehen, mit denen die Duden-Redaktion uns einfangen will. Doch es gibt kein Entkommen. Am Ende habe ich 15 Fehler.
„Ein Diktat zu schreiben ist nicht die coolste Sache der Welt“, sagt Michael Prior, der Geschäftsführer der Bohnenkamp-Stiftung, und ich muss an die Kurznachrichten denken, die meine Kinder mir jeden Tag aufs Handy schicken. Groß- und Kleinschreibung nach dem Zufallsprinzip, Tippfehler in jedem zweiten Wort, spontane Abkürzeritis und nicht einmal der Versuch, zwischen „das“ und „dass“ zu unterscheiden. Und was macht der Papa, um dem Verfall der Rechtschreibung etwas entgegenzusetzen? Schreibt jede SMS auf Punkt und Komma genau, korrigiert Fehler, und kontrolliert vor dem Absenden noch einmal jedes Wort. Ob meine heldenhafte Mission überhaupt wahrgenommen wird?
Ich bin nicht allein und schon gar nicht der Älteste, der den Kampf aufnimmt. Zum Diktatwettbewerb in der Kunsthalle haben sich auch die Cousinen Sarrah (11) und Safia (9) angemeldet. Sie finden Diktatschreiben sogar cool. „Ich habe meist null Fehler“, strahlt Sarrah, und verrät, dass ihr Papa aus Tunesien stammt, ebenso wie der Papa von Safia.
Null Fehler – in diesem Diktat wird es das nicht geben, nicht einmal bei den Lehrern. Der Text, den die Germanistikprofessorin Christina Noack unter Verschluss hält, strotzt nur so von grammatikalischen Hinterhältigkeiten. Ausgebrütet hat ihn die Redaktion des Dudenverlags. Und weil das Diktat zeitgleich in Osnabrück, Hamburg und Frankfurt geschrieben wird, haben die Verfasser für jede Stadt ein paar regionale Bezüge eingebaut.
Читать дальше
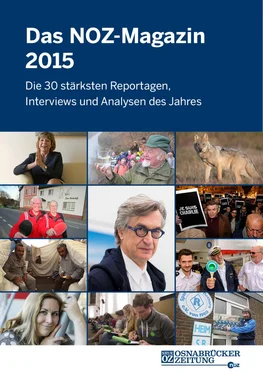

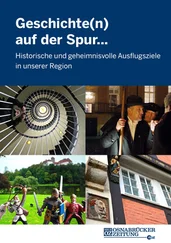

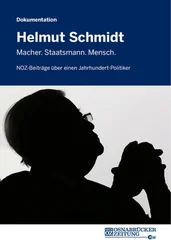
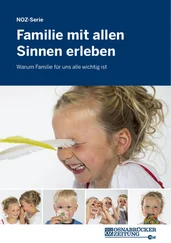

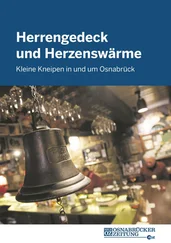
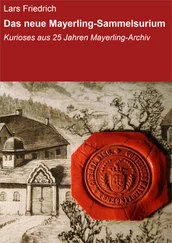
![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)