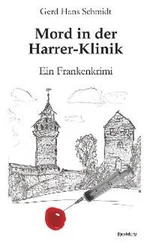Max geht von der Straße wieder die Stufen zum U-Bahnhof hinunter, wartet im Quergang einen Moment, bis er allein ist, zieht den Mantel aus und kommt auf der anderen Seite als amerikanischer Soldat wieder ans Tageslicht. Frank wartet mit der Badewanne in der Nebenstraße. Max steigt ein, sagt: „Rolling Stone Nummer zwei rollt.“ – „Und zurück“, sagt Frank und startet den Wagen. „Was schätzt du, wie viele Leute raus wollen?“, fragt Max. – „Von hier? Alle.“ – „Im Ernst.“ – „Die Hälfte. Ist mir aber schnuppe, ich will nur schnell nach Hause, da ist’s schön.“ – „Lass zweihundert Straßenbahnfahrer raus, dann jeden dritten U-Bahnfahrer und der öffentliche Nahverkehr kollabiert.“ – „Glaub ich nicht, Max. Die sind wie Ameisen. Wenn Arbeiter fehlen, legt die Königin die notwendigen Eier. Fehlen Soldaten, sind’s rote. Ja, die sorgt schnell für Nachschub: Du kriegst eine Postkarte ins Haus, musst nicht an die Front, aber zur Fahrschule für Straßenbahnen. So einfach ist das.“ – „Und wenn Ärzte abhauen? Wie willst du so schnell neue ausbilden?“ – „Hunde und Ärzte hält man hier an der Kette, Max.“ – „Beeil dich, hab Kopfweh, muss an der Luft liegen.“ – „Ich will auch gleich zur Einheit zurück.“
***
Im Büro sitzt Max am Tisch, hat einige Blätter kariertes Papier vor sich, ein Lineal und einen Bleistift. Er schreibt Rolling-Stones-Liste, teilt einige Spalten ein, schreibt über die erste Name, über die zweite Erstkontakt, dann Zweitkontakt, dann Besonderheiten, Fluchtdatum, geglückt, Kosten/DM, Gewinn/DM, zeichnet einige Zeilen. Dann füllt er die erste für Julia Lamprecht aus, die zweite für Klaus Rasig, die dritte für Ilse Barnick. Er trinkt Kaffee, isst einen Pfannkuchen, zerreißt das Blatt, fängt neu an, zeichnet keine Spalten, nur einen Strich unter Rolling-Stones-Liste und schreibt zu Julia Lamprecht, was ihm in den Sinn kommt. Genauso für die andern. Er denkt an Klaus Rasigs Stadtansichten, an die Düsseldorfer Kö, die Klaus nie gesehen hat, höchstens im Fernsehen, Westprogramm. Klaus hat sich seine eigene Kö gezeichnet, wie er sie sich wünscht oder vorstellt. Genauso den Weihnachtsmarkt in Nürnberg, den Hamburger Hafen, die Münchner Frauenkirche, das Schloss Charlottenburg. Max stellt sich vor, wie Klaus Rasig hinter seinen Hausfliesen immer weiter zeichnet, zwanzig Jahre lang, dreißig, wie seine Bilder immer schöner werden, weil etwas Wichtiges drin steckt und immer mächtiger wird: die Sehnsucht. Wie seine Bilder zur Jahrtausendwende sehenswerter sind als die Wirklichkeit – ja, eigentlich müsste man ihn drüben lassen. Bleib da, Junge, leide und werde ein Maler, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat! Hier bei uns wirst du nur reich und satt und faul und es reizt dich keine Sehnsucht, hier bist du frei, darfst alles und machst nichts.
Wedding, Seestraße 114, abends. Max hat in seinen Kadett eine neue Rückscheibe einbauen lassen, parkt auf der Straße ganz in der Nähe, geht in den Hinterhof, weiter in den zweiten, in den dritten, hört die Kühe im Stall und ihre Eisenketten. Hinter einem der Fenster wird wieder gestritten. Das Lagerfeuer ist aus, der Hof, den nur die Lampe über der Tür beleuchtet, ist leer und trostloser denn je. Jemand öffnet ein Fenster, kippt eine Schüssel aus, das Wasser klatscht auf den Boden. Max versteckt sich im Stall, riecht das warme Vieh und das Heu, wartet. Wenn ihn jetzt Paretzke anspräche, von hinten über der Schulter: Willste melken, Max? Traust du dir nicht zu viel zu? – Nein, alles.
Es vergeht eine halbe Stunde, bis vom Hof Motorengeräusche zu hören sind, dann ist es wieder still. Eine Weile später steigt jemand aus – warum erst jetzt? – Schritte Richtung Haus sind zu vernehmen. Max erkennt Paretzke an seiner Statur und der Mütze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hat. Paretzke schaltet das Funzellicht an, geht die Treppe hinauf. Max schleicht hinterher, Paretzke hört es nicht, ist laut. Da räuspert Max sich, Paretzke erschrickt, lässt den Wohnungsschlüssel fallen, greift augenblicklich in seine Manteltasche. Max sagt: „Wir sind noch nicht quitt“ – und sieht, dass dem Mann Tränen übers Gesicht rollen. Paretzke hebt den Schlüssel auf, öffnet die Tür, betritt wortlos die Wohnung. Max zögert, dann geht er hinterher, durch den langen Flur ins Berliner Zimmer und in das letzte mit dem Schreibtisch und dem Kamin, der noch ein wenig Wärme abgibt. Paretzke setzt sich, Max bleibt an der Zimmertür stehen. „Ihr habt mir den Wagen ausgeraubt“, sagt er. Paretzke reibt sich die Augen, wirkt jetzt wie ein großes Kind. „Mein kleiner Bruder. Sie haben ihn festgenommen, drüben an der Bernauer. Willi wollte abhaun.“ Max ballt eine Faust, schlägt gegen den Türrahmen, dann geht er ohne ein Wort hinaus, in den Hof zurück, zur Straße, zum Auto, fährt ab.
Frank ist ein paar Tage nicht aufgetaucht. Max hat ihn auch nicht in seiner Wohnung in B angetroffen, sorgt sich um ihn, erwägt, die Tür aufzuschließen, um nachzusehen, ob ihm etwas Schlimmes passiert ist, verwirft den Gedanken aber gleich wieder. Sein Freund Jim weiß auch nicht, was mit ihm los ist, aber dann erfährt Max, dass Frank drei Tage nicht im Dienst war und am Morgen über Frankfurt nach L.A. geflogen ist, wegen einer Familiengeschichte. Max wundert sich nicht darüber; Soldaten erhalten für Heimflüge preiswerte Tickets und Frank hat noch Urlaub aus dem letzten Jahr übrig. Max fragt sich aber, warum sich Frank nicht verabschiedet hat, obwohl er sonst wegen jeder Kleinigkeit aufkreuzt.
Max’ Bruder Manni ist zu Besuch, sie sitzen beim Wein zusammen, was Carola sehr genießt, nicht nur, weil Manni ein lustiger Geschichtenerzähler ist, sondern weil Max sich endlich mal einen Tag freigenommen hat. Sie hat ein Mittagessen vorbereitet, ein Braten schmort im Backofen. Manni berichtet von seinem Umzug, er wohnt seit Januar in einem der neuen Häuser in der Berliner Straße in Tegel. „Der Altbau ist passé“, sagt er, „man sollte sie alle abreißen. Zuerst die Hinterhöfe, guck dir die Verhältnisse im Wedding an: Man wohnt zu fünft im Hühnerstall, Klo auf dem Dach, das Volk scheißt ins Treppenhaus wie einst der Sonnenkönig, nur dass der damals seine Köttelmädchen hatte. Ja, im Wedding kann man sich solch einen Luxus nicht leisten.“ – „Wie bei Zille“, pflichtet Carola bei. Da klingelt es an der Wohnungstür. Carola öffnet, spricht mit jemandem auf Englisch. Max begibt sich ebenfalls zur Tür. Jim steht dort: „Frank hat angerufen. Aus L.A.. Ist krank, Rückflug verschoben, bis Donnerstag. Ich fahre für ihn.“ Carola geht ins Zimmer zurück, Max spricht so leise, dass sie es nicht hören kann: „Ich will am späten Nachmittag rüber, wenn Berufsverkehr ist. Die haben letztens einen Jeep zur Seite gewunken, mittags in der Schloßstraße, als da kaum was los war. Ich stand zufällig dabei, das waren eure Leute!“ – Jim antwortet nicht, bemerkt aber, dass es hier gut rieche. Max will ihn nicht einladen, denn Carola hat zurzeit „genug von den Amis“, wie sie sagte. „Montag, 17 Uhr?“, flüstert Max und fügt hinzu: „Die erwarten uns am Abend.“ – „Dann können wir fünfmal rüber.“ – „Einmal reicht. Wenn wir zu früh sind, drehen wir noch ‘ne Runde. Sprich mit keinem darüber!“ – „Und was ist hiermit?“, fragt Jim und tippt sich auf die Hand. – „Zweihundert Dollar“, antwortet Max. „In Ordnung“, sagt Jim und verabschiedet sich, nicht ohne noch einmal einen Blick in Richtung der Küche zu werfen.
„Mein Supermann macht mal wieder was und ich sorge mich zu Tode“, sagt Carola, als Max wieder am Tisch sitzt. „Übertreib nicht, außerdem lasse ich es machen“, antwortet er, eine glatte Lüge. „Ja, ihn treibt das Menschliche – oder ist es das Portemonnaie?“, lästert der Bruder und fragt: „Was zahlen sie dir denn?“ – „Weiß noch nicht, ich werde schon was verlangen.“ – „Tausend Ostmark? Dafür kannst du dir im Westen ein halbes Kondom kaufen.“ – „Die Frau hat Gold. Von den Nazis.“ – „Aha, von den Juden geklaut. Natürlich bevor man sie …“ Max steht auf, geht zum Fenster, sagt: „Es liegt da rum, ist darum nicht gut oder schlecht.“
Читать дальше